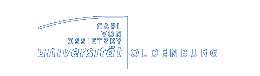

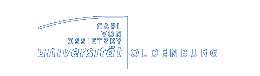  |
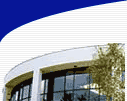
|

Themen
|
|||||||||||||||
 |
Wolf Lepenies (links) bei der Podiumsdiskussion seiner Jaspers-Vorlesunge mit dem Diskussionsleiter Prof. Dr. Ulrich Ruschig (Mitte) und Christopf Gödde, einem der zwei Jaspers-Preisträger. Foto: Wilfried Golletz |
Prof. Dr. Wolf Lepenies, Permanent Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin,
hielt in diesem Jahr im Rahmen der Karl Jaspers Vorlesungen zu Fragen
der Zeit den Vortrag „Kultur auf Kosten der Politik“, der hier
in Auszügen wiedergegeben wird. Lepenies ist unter anderem Mitglied
der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, der American Academy
of Arts and Sciences und der französischen Académie Universelle
des Cultures. Er wurde vielfach ausgezeichnet und ist Ehrendoktor der
Pariser Sorbonne und Offizier der Französischen Ehrenlegion.
Am 17. August 1946 entschuldigt sich Hannah Arendt bei Karl Jaspers, weil
sie ihm seit über einem Monat nicht geschrieben hat. Sie hat es nicht
getan, weil sie Jaspers‘ Schrift „Die Schuldfrage“ gelesen
hat - und von dem Gelesenen verstört ist. Anstoß nimmt sie
daran, dass Jaspers die Verbrechen der Nazis strafrechtlich zu werten
versucht.
Diese Verbrechen lassen sich“ - schreibt Hannah Arendt - „juristisch
nicht mehr fassen, und das macht gerade ihre Ungeheuerlichkeit aus. Für
diese Verbrechen gibt es keine angemessene Strafe mehr; Göring zu
hängen, ist zwar notwendig, aber völlig inadäquat. Das
heißt, diese Schuld, im Gegensatz zu aller kriminellen Schuld, übersteigt
und zerbricht alle Rechtsordnungen. Dies ist auch der Grund, warum die
Nazis in Nürnberg so vergnügt sind; sie wissen das natürlich.“
Karl Jaspers antwortet auf diesen Einwand erst in seinem übernächsten
Brief vom 19. Oktober. Dem Dank für Paketsendungen, die ihm und seiner
Frau ein Leben „wie im Frieden“ ermöglichen, folgt die
Zurückweisung der Kritik, die Hannah Arendt an der „Schuldfrage“
geäußert hat: „Ihre Auffassung ist mir nicht ganz geheuer,
weil die Schuld, die alle kriminelle Schuld übersteigt, unvermeidlich
einen Zug von ‚Größe‘ - satanischer Größe
- bekommt, die meinem Gefühl angesichts der Nazis so fern ist, wie
das Reden vom ‚Dämonischen‘ in Hitler und dergleichen.
Mir scheint, man muss, weil es wirklich so war, die Dinge in ihrer ganzen
Banalität nehmen, ihrer ganz nüchternen Nichtigkeit.“ ...
1946, im gleichen Jahr, da Jaspers‘ „Schuldfrage“ erscheint,
veröffentlicht Friedrich Meinecke „Betrachtungen und Erinnerungen“
mit dem Titel „Die deutsche Katastrophe“. Das Buch wird gelesen,
1949 erscheint bereits die vierte Auflage.
Hat der deutsche Geist die Katastrophe des Nationalsozialismus überstanden?
Meinecke registriert Lebenszeichen: „Man hört von der Gründung
von Kulturbünden und Kulturgemeinden in den Städten, man hört
von Theateraufführungen, in denen vergessene Schätze deutscher
Dramatik wieder in das Licht aufsteigen, und zu den Konzerten, in denen
große deutsche Musik geboten wird, drängen sich junge und alte
Menschen.“ ...
Meineckes naives „Wunschbild“ wird zum Zerrbild, wenn er an
„gute Erfahrungen, die aus dem Dritten Reiche stammen“, erinnert:
„Der schlaue Goebbels wusste ... ganz genau, wie man harmlose Seelen
dadurch einfangen konnte, dass man ein paar gute und preiswerte Artikel
in das Schaufenster der Partei legte. ...“ Dem „schlauen Goebbels“,
der Propaganda mit vorgeblich unpolitischer Kunst betrieb, geht Meinecke
noch posthum auf den Leim, wenn er voller Inbrunst davon spricht, „geistiges
Leben und Ringen um geistige Werte“ wirkten dort am tiefsten, wo
sie sich „am freiesten von politischer Tendenz“ bewegten. Goebbels
ist der unheimliche Pate der Meineckeschen Utopie. Die für Deutschland
charakteristische Sakralisierung von Kunstproduktion und Kunstgenuss,
die zur Entnazifizierung der Nation beitragen soll, verkehrt sich ins
Gegenteil: Über sein militärisch-politisches Ende hinaus wahrt
sie die kulturelle Kontinuität des Dritten Reiches. ...
Nach 1945 erleben Emigranten und Rückkehrer ein Wunder: „Die
auferstandene Kultur“. Diesen Titel trägt ein Essay Theodor
W. Adornos aus dem Jahr 1949. Anlass ist das Erstaunen, dass nach zwölf
Jahren Nazi-Herrschaft von einem Kahlschlag der Kultur in Deutschland
keine Rede sein kann. Statt der erwarteten Stumpfheit, Unbildung und zynischen
Misstrauens ist die Beziehung zu geistigen Dingen intensiver noch als
in den Jahren vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Am 28.
Dezember 1949 schwärmt Adorno in einem Brief an Thomas Mann von den
Erfahrungen mit seinen Studenten: „Dabei denke ich ... an das Seminar,
das, als eine etwas ungewöhnliche Vorschule zu Hegel, über die
Kantische Transzendentale Dialektik handelt. Was ich da an leidenschaftlicher
Teilnahme finde, entzieht sich der Schilderung, und es liegt sicherlich
an der Sache und nicht an mir, der es ohnehin beim Übereifer der
Studenten recht schwer hat zu Wort zu kommen. ...” 1946 hatte Karl
Jaspers in einem Brief an Hannah Arendt von ähnlichen Erfahrungen
berichtet: „Neulich ein vorzügliches Referat über die ‚Idee‘
bei Plato und bei Hegel, ganz abstrakt, - und dann eine Diskussion, so
erregt und intensiv, als ob es sich um die aktuellsten Dinge handele.“
Adorno wie Jaspers klingen, als ob Friedrich Meinecke in ihnen Sympathisanten
seiner Kultur-Utopie hätte sehen dürfen. In Wahrheit ziehen
beide aus ihren Beobachtungen der geretteten oder der auferstandenen deutschen
Kultur einen Schluss, der von den Befunden Meineckes verschiedener nicht
sein könnte. In dem soeben zitierten Brief fährt Jaspers fort:
„Diese wenigen trefflichen jungen Menschen haben für Politik
gar kein Interesse, sondern nur Verachtung und Misstrauen“ - eine
Beobachtung, die Hannah Arendt an die fatale Politikabstinenz deutscher
Kulturenthusiasten erinnert, die sie selbst noch erlebt hat: „Was
mich an Ihren erfreulichen Seminar-Studenten erschreckt, ist, dass die
nun wieder, wie wir selbst unseligen Angedenkens, an Politik uninteressiert
sind.“ ...
Am 8. September 1933 liest Thomas Mann in einer fränkischen Nazi-Zeitung,
die man ihm „sonderbarer Weise“ geschickt hat, eine Rede des
Führers über „Kultur“: „Erstaunlich. Dieser Mensch,
Exponent der kleinen Mittelklasse mit Volksschulbildung, die ins Philosophieren
geraten ist, ist wahrhaftig eine kuriose Erscheinung. Gar kein Zweifel,
dass es ihm, im Gegensatz zu Typen wie Göhring [sic] und Röhm,
nicht um den Krieg, sondern um ‚die deutsche Kultur‘ zu tun
ist. Die Gedanken, die er darüber, hilflos, sich immer wiederholend,
unter beständigen Entgleisungen und in einem erbarmungswürdigen
Stil, aneinander reiht, sind die eines hilflos bemühten Klippschülers.
Sie könnten rühren, wenn sie nicht von so grauenhafter Unbescheidenheit
zeugten. Nie haben die Mächtigen, die Tatmenschen des Weltgeschäftes,
der Politik sich angemaßt, auf diese Weise die Lehrer eines Volkes,
ja der Menschheit zu spielen.“ ...
Selbstkritische Verstörung und das bedrückende Gefühl einer
fatalen Komplizenschaft sind unverkennbar. Enthüllt nicht die theatralische
Politik des deutschen Faschismus in ihrer Widerlichkeit und Bestialität
eine Wahrheit über die deutsche Kultur und ihre traditionell gepflegte
Anmaßung, nicht nur die notwendige Kompensation der Politik, sondern
die bessere Politik zu sein? Wer an dieser Interpretation zweifelt, der
lese noch einmal jenen ungeheuren Essay mit dem Titel „Bruder Hitler“,
den Thomas Mann im März 1939 wie eine Eruption aus sich herausschleudert:
„Der Bursche ist eine Katastrophe; das ist kein Grund, ihn als Charakter
und Schicksal nicht interessant zu finden ... Muss man nicht, ob man will
oder nicht, in dem Phänomen eine Erscheinung des Künstlertums
wiedererkennen? Es ist, auf eine gewisse beschämende Weise, alles
da: die ‚Schwierigkeit‘, Faulheit und klägliche Undefinierbarkeit
der Frühe, das Nichtunterzubringensein, das Was-willst-Du-nun-eigentlich?,
das halb blöde Hinvegetieren in tiefster sozialer und seelischer
Bohème, das im Grunde hochmütige, im Grunde sich für
zu gut haltende Abweisen jeder vernünftigen und ehrenwerten Tätigkeit
- auf Grund wovon? Auf Grund einer dumpfen Ahnung, vorbehalten zu sein
für etwas ganz Unbestimmbares, bei dessen Nennung, wenn es zu nennen
wäre, die Menschen in Gelächter ausbrechen würden. Dazu
das schlechte Gewissen, das Schuldgefühl, die Wut auf die Welt, der
revolutionäre Instinkt, die unterbewusste Ansammlung explosiver Kompensationswünsche,
das zäh arbeitende Bedürfnis, sich zu rechtfertigen, zu beweisen,
der Drang zur Überwältigung, Unterwerfung, der Traum, eine in
Angst, Liebe, Bewunderung, Scham vergehende Welt zu den Füßen
des einst Verschmähten zu sehen... Ein Bruder ... Ein etwas unangenehmer
und beschämender Bruder; er geht einem auf die Nerven, es ist eine
reichlich peinliche Verwandtschaft. Ich will trotzdem die Augen nicht
davor schließen ... .“
Es gibt keinen Text deutscher Sprache, in welchem die Folgen der Machtanmaßung
der Kunst wie der künstlerischen Inszenierung der Macht, schmerzlicher
zum Ausdruck kommen als in Thomas Manns von Abscheu und Faszination gemischter
Abrechnung mit seinem „Bruder“ - mit Adolf Hitler. Auf die Anmaßung
der Kultur, die bessere Politik zu sein, antwortet der Größenwahnsinn
einer Politik, die sich als Kultur aufspielt. Goethe als Übervater
- das war die deutsche Sehnsucht; Hitler als Bruder - das wurde die deutsche
Wirklichkeit.
Zeigte sich im Kulturanspruch der Nazis ein Bruch oder Kontinuität
mit der deutschen Geschichte? Die Diskontinuitätsthese teilt Deutschland:
Dem Land der Hitler, Himmler und Goebbels wird das Land Hölderlins,
Goethes und der Brüder Humboldt gegenübergestellt. Beide Länder
haben nichts miteinander zu tun. Angeblich sind sie noch nicht einmal
Nachbarn. Das geistige und das garstige Deutschland muss besonders scharf
voneinander trennen, wer sich zum Weg in die innere Emigration entschließt.
...
Auf der anderen Seite fehlte es im In- und Ausland nicht an Versuchen,
nach den gemeinsamen Wurzeln deutscher Kultur und deutscher Politik zu
suchen. Mehr noch: Lag nicht vielleicht der Ausgangspunkt der deutschen
Irrwege im Bereich des Geistigen? War Wilhelm von Humboldt ein Vorläufer
Wilhelms II.? Auch das „Innere Reich“ rief Irritationen und
Angst hervor. Der Philosoph George Santayana schrieb, wann immer er sich
mit deutscher Metaphysik beschäftige, laufe es ihm kalt über
den Rücken und ein dumpfes Gefühl der Bedrohung ergreife von
ihm Besitz... .
Distanz zur Demokratie, Hassliebe zur Latinität - wobei Frankreich
eine herausgehobene Rolle spielt -, und die Entgegensetzung von Europäismus
und Deutschtum sind Leitideen deutscher Kunstgesinnung und Geistespolitik
im 20. Jahrhundert. Sie sind im hohen Maße mitverantwortlich dafür,
dass der deutsche Geist 1933 nicht nur in Gefahr gerät, sondern darin
umkommt. Diese Leitideen überleben nicht nur bei den Mitläufern
und Sympathisanten des Regimes, sie bleiben in der inneren wie in der
äußeren Emigration lebendig. Sie überstehen auch das Ende
des Zweiten Weltkrieges und prägen künstlerische Entwicklungen
und kunstpolitische Debatten der Nachkriegszeit.
Drei Entwicklungen sind für ihr Absterben verantwortlich: Die zunehmende
Akzeptanz der Demokratie, die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten
und das Zusammenwachsen Europas. Die nationale Idee, an der sich die Kunst
rieb und mit der sie sich verbündete, wurde zum Anachronismus. Nicht
die militärische Niederlage und die politische Katastrophe von 1945
haben dem spezifisch deutschen Komplex von Staat und Kultur, von Macht
und Geist den Boden entzogen, sondern die Erfolgsgeschichte der deutschen
Nachkriegsdemokratie. ...
Nach 1945 waren in der Bundesrepublik Traditionskerne der deutschen Kunst
und Wissenskultur nur noch in Mischformen vorhanden. Es kommt zu einer
Vermengung deutscher und internationaler Wissensbestände und Kunsttraditionen,
die nationaltypische Ausfilterungen kaum mehr gestattet. Diese Mischkultur
wird in hohem Masse konkurrenzfähig. Die Kultur profitiert von der
militärischen Niederlage - und die Politik profitiert von der Kultur.
Die frühe kulturelle Westorientierung der Bundesrepublik nimmt ihre
Integration in das westliche Bündnis vorweg und trägt zu seiner
Stabilisierung wesentlich bei.
Und dennoch steckt auch in dieser Kultur und Politik verknüpfenden
Erfolgsgeschichte ein Stück Ambivalenz. Ich erinnere an den Brief
Adornos an Thomas Mann vom 28. Dezember 1949, aus dem ich am Anfang zitierte.
Im Ernst, schrieb damals Adorno, dächte niemand mehr daran, von Deutschland
aus Geschichte zu bestimmen. Die Deutschen wollten, „im äußeren,
an die Mächte sich halten und durchschlüpfen - und im übrigen
‚tatenarm und gedankenvoll‘ sein, als schriebe man 1800.“
Adorno sah voraus, dass über Jahrzehnte die Deutschen tatsächlich
weniger Politik machen, als mit ihrer Politik in Europa „durchschlüpfen“
würden. ...
Spätestens nach dem Ende des Kommunismus aber und mit der Wiedervereinigung
war es mit dieser selbstverständlichen Entlastung vorbei. Deutschland
wurde dazu gezwungen, seine nationalen Interessen zu definieren und nach
außen zu vertreten. Im Prozess der Wiedervereinigung wurde noch
einmal die Kultur gegen die Politik ausgespielt. Zur unabgetragenen Hypothek
der Wiedervereinigung gehört das Versäumnis, die aus der Protestbewegung
der DDR hervorgegangenen Eliten in politische Führungspositionen
des geeinten Deutschlands bringen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Auf der einen Seite war das westdeutsche Politikestablishment viel zu
festgefügt, als dass es alternative Politikstile ernsthaft hätte
integrieren wollen. Auf der anderen Seite hatte sich innerhalb der DDR
in Zirkeln, die über lange Jahre nur im Privaten wirken konnten,
ein Verständnis von Politik entwickelt, das diese unter einen Erwartungsdruck
stellte, dem die parlamentarische Demokratie nicht gerecht werden konnte.
Bärbel Bohleys enttäuschter Ausruf, man habe sich Gerechtigkeit
erwartet und dafür nichts bekommen als den Rechtsstaat, war dafür
das Beispiel: Hierin drückte sich die Ablehnung der Parteiendemokratie
aus, die notwendigerweise mit Kompromissen arbeitet und zu Problemlösungen
auf Dauer nicht in der Lage ist. Die sogenannte „alte Bundesrepublik“
wurde mit einem „uralten“ deutschen Politikanspruch konfrontiert,
der sich an Maximal-Maximen orientiert, wie sie in der Kultur durchaus
legitim sind, in der Parteiendemokratie aber nur zerstörerisch wirken
könnten.
Innerhalb einer Generation wird diese gesamtdeutsche Hypothek getilgt
sein. Jetzt steht Europa auf der Tagesordnung - und es scheint, als kehre
nunmehr ein deutsches Problem in europäischer Verkleidung zurück.
Gegenüber den mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten
zur Europäischen Union wurde „Kultur“ lange Zeit als Kompensations-
und Trostbegriff benutzt. Wohlfeiles Kulturlob verdeckte, dass den Kandidaten
sowohl die vollständige politische Partizipation in der Gemeinschaft
als auch die Freiheit des Handels vorenthalten wurden. Auch dieses Problem
wird - nach einer Übergangsfrist - verschwinden. Jetzt treten verstärkt
Kultur-Lobbies auf, die - nicht ohne Berechtigung - darüber klagen,
dass in Europa die Kulturpolitik gegenüber anderen Politikfeldern
vernachlässigt wird. Kulturpolitik soll zu einem konstitutiven Bestandteil
der Europapolitik werden. Dem wird niemand widersprechen. Hier aber droht
zugleich eine Gefahr: Die Behauptung, Europa leite seine Identität
vorrangig aus der Kultur ab, könnte dazu verführen, in Zukunft
Kultur als Kompensation einer gesamteuropäischen Außen- und
Sicherheitspolitik zu nutzen. Nichts aber benötigt Europa im Augenblick
dringender als ein gemeinsames Handeln in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Auch hier kann die Kultur kein Ersatz der Politik sein.
Für Deutschland bleibt die Aufgabe, darauf zu achten, dass die Überschätzung
der Kultur auf Kosten der Politik ein Problem der deutschen Vergangenheit
bleibt und nicht zu einem Problem der europäischen Zukunft wird.
Der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht“. Diese Feststellung
Goethes könnte durchaus auch der Hintergrund eines Projekts sein,
das die Universitätsverwaltung im vergangenen Jahr startete: eine
Messung der Dienstleistungsqualität der zentralen Verwaltung der
Universität Oldenburg. Ziel des Projekts war es, Anhaltspunkte
für die Verbesserung von Verwaltungsprozessen und -leistungen zu
finden sowie die Zusammenarbeit innerhalb der Universität auf der
Grundlage eines langfristigen Organisations- und Personalentwicklungsprozesses
zu fördern.
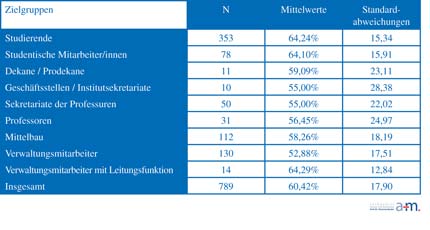
Für die Organisation des Projekts wurde ein Team zusammengesetzt,
das dem Lehrstuhl für Absatz und Marketing die Aufgabe übertrug,
die Studie praktisch durchzuführen. Das Team entschied sich, neuere
Entwicklungen in der Verwaltungsforschung aufzugreifen und die Qualität
des Verwaltungshandelns am Zufriedenheitsurteil der internen „Kunden“
über die Leistungen der internen „Anbieter“ zu messen.
Interne „Anbieter“ von Verwaltungsdienstleistungen waren im
Rahmen der Untersuchung die Dezernate 1 bis 5 sowie die Stabsstellen
Presse & Kommunikation, Akademisches Auslandsamt, Rechtsberatung,
Dialog, Kooperationsstelle Universität-Gewerkschaften und Arbeitssicherheit.
Als interne „Kunden“ wurden alle Universitätsangehörigen
einbezogen: ProfessorInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen, StudentInnen
sowie die MitarbeiterInnen des technischen und des Verwaltungsdienstes.
Für jede Zielgruppe wurde ein individueller Fragebogen entwickelt,
der die Zufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit der internen Dienstleistungsanbieter
(dem „Können“), dem Ablauf der Dienstleistungserstellung
(Eingehen auf individuelle Probleme, Schnelligkeit etc.) und dem Ergebnis
der für sie relevanten Dienstleistungen ermittelte. Einschränkungen
waren allerdings dahingehend vorzunehmen, dass eine Reihe von Verwaltungsleistungen
aufgrund gesetzlicher Regelungen oder Anordnungen im Ergebnis eindeutig
festgelegte Vollzugsaufgaben sind. In diesen Fällen verfügen
die VerwaltungsmitarbeiterInnen kaum über Handlungsspielräume
bei der Gestaltung des Ergebnisses (Beispiel: Vollzug einer Personaleinstellung)
und können somit auch keinen Einfluss auf die (Un-)Zufriedenheit
mit dem Ergebnis nehmen. Aus diesem Grund wurde in der Studie der Schwerpunkt
auf die Messung der Zufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit der
Verwaltungseinheiten und dem Ablauf der Verwaltungsdienstleistung gelegt.
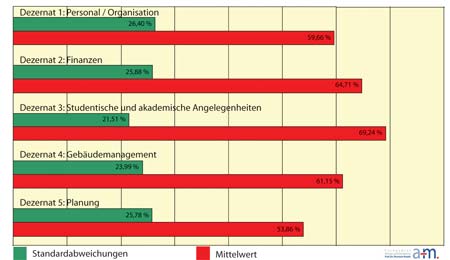
Die Auswertung der Befragung zeigt ein breites Spektrum der Zufriedenheitsurteile
mit der Verwaltungsleistung. Insgesamt beteiligten sich rund 500 Beschäftigte
der Universität (Rücklaufquote: 23 Prozent) und 360 StudentInnen
an dieser Befragungsaktion. Das globale, alle Leistungen der zentralen
Verwaltung übergreifende Zufriedenheitsurteil betrug 60,5 Prozent
auf einer Skala von 0 Prozent (= sehr unzufrieden) bis 100 Prozent (=
sehr zufrieden). Zur Einordnung dieses Wertes lässt sich das „Kundenbarometer“
als regelmäßig erhobene nationale Zufriedenheitsstudie heranziehen:
im Vergleich mit den (Extrem-)Werten für den Bahnfernverkehr (45
Prozent) und KfZ-Versicherungen (71 Prozent) befindet sich die Universitätsverwaltung
mit diesem Wert im oberen Mittelfeld der erhobenen Dienstleistungsanbieter
(Stand 2001/2002); ermutigend ist, dass der Vergleich mit den Stadt-
und Kreisverwaltungen (51 Prozent) deutlich zugunsten der Universitätsverwaltung
ausfällt.
Schlüsselt man die Gesamturteile nach den internen Anbietern auf,
so ergeben sich deutliche Unterschiede. Wie der Abbildung zu entnehmen
ist, variiert das Spektrum der Zufriedenheitsurteile für die Dezernate
von 53,86 Prozent bis 69,24 Prozent. Die unerwartet starken Unterschiede
werfen die Frage auf, ob diese ausschließlich auf Unterschiede
der jeweiligen Dienstleistungsqualität zurückzuführen
sind. Anhaltspunkte für systematisch begründete Unterschiede
ergeben sich, wenn die Zufriedenheit der internen Zielgruppen betrachtet
wird (Tabelle): Überdurchschnittlich zufrieden urteilten die Studierenden
und die Leitung der Verwaltung. Im Gegensatz dazu sind die „Kunden“
in den (ehemaligen) Fachbereichen und die Verwaltungsmitarbeiter deutlich
unzufriedener. Unsicherheit und Unzufriedenheit angesichts der laufenden
Organisationsreform kommt hier vermutlich verstärkt zum Tragen.
Auch nimmt die Zufriedenheit mit der Dauer der Zugehörigkeit zur
Universität ab. Dies lässt den Schluss zu, dass die Gesamturteile
für die einzelnen Dezernate und Stabsstellen auch durch deren jeweilige
„Kunden“struktur bestimmt sind. Die Betrachtung der (Un-)Zufriedenheit
der Kundengruppen fördert dann auch unterschiedliche Schwerpunkte
zu Tage: Wird von Seiten der Studierenden vor allem eine bessere Leistung
im Zusammenhang mit Problemen und Fragestellungen der Studienförderung
sowie des Auslandsstudiums erwartet, stehen für die Dekane und
Professoren Verbesserungswünsche bei der Abwicklung von Finanzierungsfragen
und Raumnutzung im Vordergrund; bei den MitarbeiterInnen in der Verwaltung
dominieren Unzufriedenheiten mit der Bewertung und Eingruppierung des
Arbeitsplatzes, während auf Ebene der Instituts- und Lehrstuhlsekretariate
die Kommunikation mit der Verwaltung und die Leistungen im Weiterbildungsbereich
besonders kritisch bewertet werden.
Es ist zu folgern, dass es nicht den mangelhaften internen Dienstleister
gibt, sondern dass vielmehr eine stärkere Ausrichtung der einzelnen
Verwaltungsleistungen an den unterschiedlichen Erwartungen ihrer Abnehmergruppen
erforderlich ist. Es zeigte sich, dass die Universitätsmitglieder
mit der Kompetenz der Verwaltungsmitarbeiter insgesamt zufriedener sind
als mit Merkmalen des Prozesses der Leistungserstellung wie z. B. „Schnelligkeit“
und „Erreichbarkeit“. Die Verwaltung sollte deshalb verstärktes
Augenmerk auf die Organisation ihrer internen Abläufe werfen.
Auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse sind gegenwärtig umfassende
Maßnahmen in Richtung einer kundenfreundlicheren und zugleich
effizient arbeitenden Verwaltung in Vorbereitung.
 *
Prof. Dr. Thorsten Raabe,
*
Prof. Dr. Thorsten Raabe,
Fachgebiet Absatz und Marketing,
Institut für Betriebswirtschaftslehre
und Wirtschaftspädagogik.