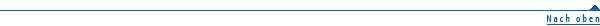Hochschulzeitung UNI-INFO
Kontakt
Hochschulzeitung UNI-INFO
Ausgabe 3/2011
Thema
Was für die Gemeinschaftsschule spricht
Elsbeth Stern über Intelligenzunterschiede und die pädagogischen Herausforderungen, die daraus entstehen
 Prof. Dr. Elsbeth Stern (Foto) ist Expertin für Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössi-schen Technischen Hochschule Zürich (Schweiz). Im Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen der Erwerb, die Veränderung und die Nutzung von Wissen. Die Psychologin war Gast eines interdisziplinären Workshops zur Vernetzung von Neurowissenschaften, Lehr- und Lernforschung und Kognitiver Modellierung, der im März am Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) stattfand. In diesem Rahmen hielt sie an der Universität Oldenburg den Vortrag „Begabte Gehirne – Was müssen wir tun, um die oberen 15 Prozent gezielt zu fördern?“, den UNI-INFO stark gekürzt wiedergibt. Ausgangspunkt sind ihre Ausführungen zur anthropologischen Differenz.
Prof. Dr. Elsbeth Stern (Foto) ist Expertin für Lehr- und Lernforschung an der Eidgenössi-schen Technischen Hochschule Zürich (Schweiz). Im Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen Arbeit stehen der Erwerb, die Veränderung und die Nutzung von Wissen. Die Psychologin war Gast eines interdisziplinären Workshops zur Vernetzung von Neurowissenschaften, Lehr- und Lernforschung und Kognitiver Modellierung, der im März am Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) stattfand. In diesem Rahmen hielt sie an der Universität Oldenburg den Vortrag „Begabte Gehirne – Was müssen wir tun, um die oberen 15 Prozent gezielt zu fördern?“, den UNI-INFO stark gekürzt wiedergibt. Ausgangspunkt sind ihre Ausführungen zur anthropologischen Differenz.

| „Unterschiedliche Schüler können unterschiedliche Dinge bei gleichen Angeboten lernen“, so Stern. Foto: fotolia |
Worin unterscheiden sich Menschen von anderen Säugetieren? (...) Zur Beantwortung dieser Frage sollte man sich vor Augen führen, dass die meisten Säugetiere ihre Umwelt nicht gestaltet haben. Menschen hingegen haben das sehr ausgiebig getan. Wir haben das Gehirn von Steinzeitmenschen, aber damit haben wir eine Menge gemacht und unsere Umwelt nachhaltig verändert. (…) Schrift, mathematische Symbolsysteme, Konzepte, die heute jedes Grundschulkind versteht, gehören erst seit wenigen hundert Jahren zum Kulturschatz der Menschheit. (…)
Wir sind zudem die sozialsten Lebewesen, die es gibt. Niemand kooperiert so gut miteinander (wahrscheinlich ist auch niemand so fies innerhalb einer Spezies, aber das ist Teil des Spiels). Wir haben Sprache, wir besitzen die Fähigkeit zur symbolischen Wissensrepräsentation. Darüber verfügen andere Lebewesen nicht. Und wir haben die Fähigkeit, langfristige Pläne aufzustellen. (…) Dass wir so sind, wie wir sind, haben wir nicht nur unserem Gehirn zu verdanken, sondern auch unserer Kultur. Beispielsweise können sich Menschen im ostasiatischen Raum mehr Ziffern merken als wir. Das liegt nicht daran, dass sie ein größeres Gehirn haben, sondern dass sie kürzere Bezeichnung für die Ziffern haben und sich deshalb in kurzer Zeit mehr merken können. Was wir als Individuen an geistigen Fähigkeiten mitbringen, das schulden wir nicht nur unserem Gehirn, sondern vor allem dem kulturellen Umfeld und den Symbolsystemen der Kultur, in die hinein wir geboren wurden. (…)
Intelligenz: Varianz und Normalverteilung
Jede Lehrerin, jeder Lehrer weiß es. Sie haben ein Jahr lang alle Kinder gleich behandelt. Aber bei dem, was sie dazugelernt haben, gibt es riesige Unterschiede. Und man wüsste natürlich gerne, warum (…).
Die Psychologen haben ein wichtiges Konzept entwickelt, das immer wieder kontrovers diskutiert wird, aber trotzdem zum Besten gehört, was in der Disziplin entwickelt wurde, nämlich das Intelligenzkonzept (…). Intelligenztests sind im Prinzip sehr einfache Tests. Sie unterscheiden zwischen Menschen, die unter gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. Und wenn man viele solche Aufgaben vorgibt, kann man das errechnen, was man den Intelligenzquotienten, den IQ, nennt. (…) Wenn man eine große Batterie solcher Aufgaben vielleicht 1.000 zufällig ausgewählten Menschen vorgibt, dann findet man eine Verteilung – die Normalverteilung. (…) Die meisten Menschen erbringen eine mittlere Leistung, 15 Prozent liegen eine Standardabweichung über dem Mittelwert – daher der Titel meines Vortrags. Intelligenzmessung in der Psychologie bedeutet einfach nur, dass man untersucht, wie weit jemand vom Mittelwert abweicht. (…)
Heutzutage kann niemand mehr behaupten, dass die Unterschiede, die es in der Intelligenz gibt, allein durch die Umwelterfahrungen zustande gekommen seien. (…) Es gibt eine Posse der Natur, die uns knallharte Daten liefert, und das sind Zwillingsstudien. (…) Der Intelligenzquotient ist bei eineiigen Zwillingen fast identisch; zweieiige Zwillinge dagegen weisen nur eine mittelmäßige Ähnlichkeit auf. Ihr IQ entspricht dem anderer Geschwister, die ja in der Regel unterschiedlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Diese Tatsache lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als die, dass die Gene beim Zustandekommen von Intelligenzunterschieden eine große Rolle spielen. (…) Intelligenz ist eine Fähigkeit, die sich entwickeln muss, und das kann sie nur innerhalb einer bestimmten Umwelt. (…) Also die Varianz in der Intelligenz ist zwar da, aber es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten auch zwischen Menschen, die nicht so günstige Voraussetzungen mitbringen. Der wichtigste Satz ist: Individuelle Unterschiede in komplexen psychischen Merkmalen zeigen sich erst, nachdem Umweltfaktoren wirksam wurden. Das, was wir unter Intelligenz verstehen, kann sich nur in Gesellschaften entwickeln, die ein Schulsystem haben, die Schrift und andere Symbolsysteme haben. (…)
Obwohl wir wissen, welche Bedeutung Gene für die Entstehung von Intelligenz und Intelligenzunterschieden haben, haben wir nicht die geringste Ahnung, wo auf unserem Genom die Gene sitzen, die dafür sorgen, dass wir einen IQ von 115 oder 130 bekommen. (…) Intelligenz wird eben aufgrund vieler genetischer Merkmale vererbt. (…)
Was nötig ist, damit die Intelligenz, die einer hat, sich entwickeln kann, sind Standardernährung, emotionale Geborgenheit und natürliche Sprachförderung. Das wissen wir heute. Bei Kindern ab zwei Jahren kann – muss nicht, aber kann – die soziale Herkunft zuschlagen, wenn die Kinder nicht normal in Kommunikationsprozesse eingebunden werden. Das kann natürlich auch bei anderen Familien passieren. Kinder brauchen den Zugang zu den Symbolsystemen. Das ist das Entscheidende für die Intelligenz. Von diesen Faktoren abgesehen erweist sich die Intelligenzentwicklung im Prinzip als erstaunlich robust. (…)
Intelligenzpotenziale müssen wir in der gesamten Bevölkerung suchen und sie für die Weiterentwicklung des Wissens nutzen. Die Gene steuern, auf welche Umweltangebote ein Individuum reagieren kann. Aber die Umweltangebote müssen natürlich vorhanden sein. Und Intelligenz, so wie wir sie heute verstehen, kann sich nur in einem anspruchsvollen kulturellen Kontext entfalten. Und Intelligenzunterschiede können nur in diesem Umfeld entstehen. (…)
Die besonders begabten 15 Prozent
Die Frage ist: Was bedeutet es, wenn man sehr intelligent ist und zu den oberen 15 Prozent gehört? Es ist ja erst mal schön, wenn man die Gene mitbringt und wenn man auf eine Umwelt trifft, in der man seine Intelligenz entwickeln konnte. Doch ist das jetzt der Freifahrtschein für ein bequemes und erfolgreiches Leben? Nicht unbedingt! Denn wir wissen, Intelligenz ist so etwas wie ein Grundkapital. Wer es hat, der kann es nutzen. Wer intelligent ist, aber diese Fähigkeit nicht in ein Inhaltsgebiet investiert, der hat seine Gene nicht genutzt. Deshalb ist eine wichtige Botschaft: Gute Intelligenz muss man investieren, wenn man den Benefit haben will. (…) Fehlendes Wissen kann nicht durch eine höhere Intelligenz kompensiert werden. Auch intelligente Menschen müssen lernen. Ja, Lernen macht überhaupt erst intelligent. Nur wenn ich Lerngelegenheiten wahrnehme, kann ich mein Potenzial entfalten. (…)
Hochbegabte bringen die besten Voraussetzungen für das Lernen mit. Sie sind immer erfolgreicher. Sie haben nicht mehr Probleme als andere Kinder – auch wenn das gerne behauptet wird. Dafür gibt es keine Belege. (…) Es ist dabei willkürlich, wo man die Begabung festlegt, einfach deshalb weil Intelligenz kontinuierlich verteilt ist. Sie ist normal verteilt und wir machen irgendwo Einschnitte. Der Einschnitt bei Hochbegabung liegt bei zwei Prozent (…). Meine oberen 15 Prozent sind letztlich ebenso willkürlich wie die Festlegung auf zwei Prozent. (…)
Was zeichnet die besonders Begabten – so nenne ich der Einfachheit halber die oberen 15 Prozent – im Vergleich zu den Menschen im mittleren Bereich aus? (…) Man kann zeigen, dass sich besonders Begabte schneller auf neue Ziele einstellen können. Sie sind weniger „störanfällig“. Sie machen auch Fehler, wenn sie lernen, aber sie korrigieren sich schneller. Sie sind sich stets bewusst: Es gibt Fehler, und ich muss sie korrigieren. Sie haben eine bessere Selbstkontrolle. Sie können ihre Leistungen auch ohne Rückmeldung verbessern. Sie sind kritisch genug, um zu erkennen, wo es noch Verbesserungspotenziale gibt. Sie lernen schneller und selbstständiger, aber nicht prinzipiell anders. (…)
Das dreigliedrige Schulsystem
Und jetzt ist natürlich die nächste Frage: Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass es so große Unterschiede gibt? (…) Brauchen wir unterschiedliche Schulen für unterschiedlich begabte Schülerinnen und Schüler? (…) Es ist seit Jahrzehnten festgeschrieben: das mehrgliedrige Schulsystem, das die Schüler aufteilt in diejenigen, die ein gutes akademisches Lernpotenzial mitbringen, und solche, deren Potenzial nicht so gut ist. (…). Traditionell ist man davon ausgegangen, dass Gymnasiasten anders und schneller lernen während Schüler der Hauptschulen eher konkrete Anweisungen brauchen. (…) Wenn damals schon die Normalverteilung der Intelligenz im Bewusstsein der Menschen, der Politiker, gewesen wäre, dann hätte man gesagt, es ist eigentlich keine gute Sache, willkürlich Einschnitte vorzunehmen (…).Wer gehört auf das Gymnasium und wer nicht? Man muss irgendwo einen Schnitt machen, aber je mehr man in die Mitte kommt – und in Deutschland gehen 40 Prozent der Schüler auf Gymnasien – umso willkürlicher ist die Zuweisung, weil sich hier die Leute am ähnlichsten sind. Solange nur fünf Prozent das Gymnasium besuchten, hat man weniger Fehler gemacht als heute.
Und da haben wir das größte Problem in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, dass im mittleren Bereich die Akademiker-Eltern den Lehrern die Tür einrennen, bis sie die Gymnasialempfehlung für ihre Kinder haben. Die Kinder der anderen Eltern haben das Nachsehen. Deshalb haben wir ein so extrem sozial ungerechtes Schulsystem. Wie wir das jemals wieder loswerden, weiß eigentlich niemand. Aber wir müssen uns der Tatsache stellen, dass in einem großen Bereich die Zuweisung auf das Gymnasium nicht nach Leistung erfolgt, sondern nach sozialer Herkunft. (…)
Man bräuchte unterschiedliche Schulen, wenn man nachweisen könnte (…), dass Schüler mit schlechteren Voraussetzungen einen ganz anderen Unterricht brauchen als Schüler mit besseren Voraussetzungen. Dazu gab es unendlich viel Forschung, aber die These hat man eigentlich nicht belegen können. Eine wissenschaftliche Legitimation für das Schulsystem, wie wir es haben, gibt es nicht. Was herausgefunden wurde, ist, dass alle Lernenden von gutem Unterricht entsprechend ihrer Voraussetzungen profitieren. Wenn ein Lehrer seinen Job gut macht, dann zieht er auch alle mit (…). Guter Unterricht bedeutet immer, dass der Lehrer sich um das Wissen, das die Schüler haben, kümmert, dass sein Unterricht schülerzentriert, aber lehrergesteuert ist, und dass der Lehrer seine Methoden auf den Inhalt und das Vorwissen der Schüler abstimmt. (…)
Die pädagogische Herausforderung
Wenn man den Spielraum nutzt, den die Schule bietet, dann kann man den Schülern auf sehr unterschiedlichen Ebenen gerecht werden. Es gibt genügend Spielraum, um beispielsweise jahrgangsübergreifenden Unterricht zu machen, sich mit anderen Lehrern zusammen zu tun, Leistungsgruppen zu bilden, die zeitweise zusammenkommen, ohne dass administrative Beschlüsse gefasst werden müssen. Dabei ist wichtig, dass die Lehrer in Ausbildung und Weiterbildung lernen, dass Differenzierung in Unterschiede nicht die Ausnahme ist, auch nicht ein Problem, sondern das tägliche pädagogische Geschäft. Unterschiedliche Schüler können unterschiedliche Dinge bei gleichen Angeboten lernen. (…) Lernen ist ein konstruktivistischer Prozess, in dem man punktuell aufnimmt, was man gehört oder gesehen hat und was an das eigene Vorwissen anknüpft. (…) Lernen funktioniert eben nicht wie das Füllen eines Eimers. Natürlich gehört auch dazu, dass man das Einmaleins in der Schule lernt. Dies kann langweilig sein. Aber man kann auch anders vorgehen und beispielsweise sagen: Welche Multiplikationsaufgaben führen zu einem bestimmten Ergebnis: Wie kann ich zu einer zwei kommen? Wie zu einer drei? Und so weiter. Dann lernen alle Kinder das Einmaleins, aber diejenigen, die ein wenig bessere Voraussetzungen mitbringen und vor allem die oberen 15 Prozent, die lernen mehr. Sie lernen nämlich, dass die Zahlen sich darin unterscheiden, aus wie vielen Gleichungen sie sich zusammensetzen. Und sie kriegen schon die Voraussetzungen für Primzahlen und Quadratzahlen und so weiter, ohne dass man das explizit behandeln muss. So muss Unterricht sein, dass man als Lehrer möglichst Aufgaben gibt, bei denen jeder Schüler etwas für sich rausziehen kann. Dass das gelingen kann, das machen Länder wie Finnland vor. Aber das erfordert von den Lehrern natürlich bestimmte pädagogische Kompetenzen. (…)
Was spricht für die Gemeinschaftsschule? Sie bietet sich an, nicht weil alle Kinder gleich sind, sondern gerade weil die Kinder in ihren Eingangsvoraussetzungen so unterschiedlich sind, dass man ihrer Heterogenität nicht durch ein System mit zwei oder drei Schubladen gerecht werden könnte. Das ist wichtig, und das müsste kommuniziert werden, weil einem immer wieder, wenn es um das dreigliedrige Schulsystem geht, entgegengehalten wird: Die Kinder sind nicht alle gleich. D‘accord, aber sie sind eben, wie gesagt, so ungleich. Daher kann ich zum Abschluss nur sagen: Bildungsgerechtigkeit heißt einfach nur, dass die Normalverteilung ein Stück nach oben verschoben werden kann. Die Unterschiede sind am Anfang da, sie bleiben bestehen, wenn alles gut gelaufen ist, aber alle Schüler sind einen Schritt vorwärts gegangen.