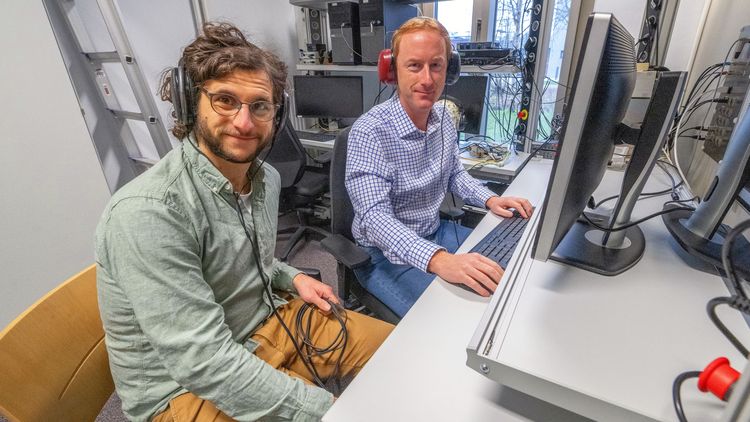Sprachassistenten verstehen Befehle nur aufgrund aufwendiger Berechnungen, die im Hintergrund ablaufen. Auch in Hörgeräten steckt viel Mathematik: Aus den Umgebungsgeräuschen errechnet eine installierte Software etwa blitzschnell, welche Teile dieser akustischen Mixtur zu dem Gespräch gehören, das der Hörgerätenutzer gerade führt – und verstärken vornehmlich diese.
Die Grundlage für solche Berechnungen bilden mathematische Modelle, die unter anderem der Oldenburger Hörforscher Prof. Dr. Mathias Dietz entwickelt. „Ein Modell ist im Grunde eine komplizierte Formel, die so gut wie möglich versucht, ein Naturphänomen zu beschreiben“, erklärt er. Im Falle seines Forschungsgebiets bedeutet das: Je besser ein auditorisches Modell funktioniert, desto zuverlässiger kann es voraussagen, wie Menschen ein Geräusch wahrnehmen würden.
Hinter dem intuitiven Wissen, woher ein Geräusch kommt, stecken komplizierte Prozesse. „Ein Ohr allein kann die Schallrichtung nur schlecht registrieren“, erklärt der Forscher vom Department für Medizinische Physik und Akustik. „Ob Geräusche von links oder rechts kommen, können wir nur erkennen, weil unsere beiden Ohren im Gehirn miteinander verschaltet sind.“ Diese Verschaltung ermöglicht es auch, Störgeräusche wie zum Beispiel das Stimmengewirr auf einer Party von der Stimme des Gesprächspartners zu unterscheiden und unbemerkt teilweise zu unterdrücken.
Vorgänger-Modell ist rund 80 Jahre alt
Ein Anhaltspunkt, der unserem Gehirn beim Richtungshören zur Verfügung steht, ist der kleine zeitliche Unterschied, mit dem ein Geräusch unsere beiden Ohren in der Regel erreicht. Eine von links kommende Schallwelle trifft zuerst das linke Ohr und wird im Innenohr in einen elektrischen Reiz umgewandelt, der dann über den Hörnerv rast. Weil die Schallwelle bis zum rechten Ohr länger unterwegs ist, startet dort der gleiche Prozess um den Bruchteil einer Sekunde verzögert. „Es gab schon in den 1940er-Jahren eine sehr intuitive Vorstellung davon, was in diesem Moment im Gehirn passiert“, sagt Dietz. Der amerikanische Physiker und Psychologe Lloyd Alexander Jeffress stellte sich das – vereinfacht dargestellt – damals so vor:
Die von rechts und links kommenden Reize bewegen sich aufeinander zu und passieren dabei eine Nervenzelle nach der anderen, bis sie schließlich an einer Nervenzelle gleichzeitig eintreffen. Weil jede Nervenzelle eine ganz bestimmte Raumrichtung repräsentiert, übersetzt das Gehirn die von zwei gleichzeitig ankommenden Reizen besonders stark erregte Zelle in eine räumliche Wahrnehmung, vermutete Jeffress, der auf dieser Grundlage ein erstes Hörmodell entwickelte. Er ging dabei von einer Vielzahl beteiligter Nervenzellen aus, die als sogenannte Gleichzeitigkeitsdetektoren die gesamte Umgebung abbilden. „Mit diesem Modell lässt sich die Wahrnehmung des Schalls gut voraussagen“, sagt Dietz. „Es gibt nur ein Problem: Eine weit verzweigte Nervenzellstruktur, wie Jeffress sie sich vorstellte, hat man bei Säugetieren im Rahmen neurowissenschaftlicher Untersuchungen rund 50 Jahre später nicht gefunden.“ Stattdessen verfügen sie lediglich über je ein Nervenbündel pro Gehirnhälfte – Forschende sprechen von Kanälen. Das Verblüffende: Obwohl Jeffress von einer falschen Annahme ausging, funktionierte sein Modell – und zwar so gut, dass Forschende und Ingenieure bis heute darauf zurückgreifen.
Diskrepanz zwischen Physiologie und Modellen für Richtungshören
Neuere Ansätze, die versuchten, die physiologischen Erkenntnisse zu berücksichtigen, konnten sich nicht durchsetzen. Die beiden Kanäle im menschlichen Gehirn wie ein auf zwei Nervenzellen reduziertes System aus Gleichzeitigkeitsdetektoren zu begreifen, machte das Jeffress-Modell unbrauchbar. Es funktionierte unter dieser – physiologisch korrekten – Annahme nicht. Insbesondere vermochten die lediglich von zwei Kanälen ausgehenden Modelle nicht zuverlässig vorherzusagen, ob Personen in der Lage sind, Zieltöne wahrzunehmen, wenn sie gemeinsam mit einem Störschall präsentiert werden.
Dietz, dessen Forschung der Europäische Forschungsrat (ERC) seit 2018 mit einem renommierten „Starting Grant“ fördert, störte die Diskrepanz zwischen Physiologie und den Modellen für menschliches Richtungshören schon bei seiner Doktorarbeit vor 15 Jahren. Der Physiker will das Hören als System verstehen. Dazu gehört für ihn, dass sich die Erkenntnisse und Modelle, die verschiedene wissenschaftliche Disziplinen beisteuern, nicht widersprechen.
Während der Pandemie, in der Hörversuche mit Probanden kaum möglich waren, konzentrierte sich Dietz mit seinen Mitarbeitern Dr. Jörg Encke und Bernhard Eurich darauf, endlich ein funktionierendes Zwei-Kanal-Modell zu präsentieren. Mit Erfolg: Das neue Oldenburger Modell kann zuverlässig berechnen, wie Menschen Töne wahrnehmen, die gemeinsam mit einem Hintergrundgeräusch abgespielt werden. Um das zu überprüfen, zogen die Forscher eine Vielzahl früherer Studien heran, in denen Forschende gemessen hatten, wie laut ein Zielton mindestens sein muss, damit die Studienteilnehmenden diesen trotz eines gleichzeitig abgespielten Störschalls wahrnehmen können. Mehr als 300 dieser sogenannten Wahrnehmungsschwellen konnte das Oldenburger Modell erstmals präzise simulieren.
Ein Umdenken brachte den Durchbruch
Ermöglicht hat diesen Durchbruch, den die Wissenschaftler kürzlich in der Fachzeitschrift „Communications Biology“ veröffentlichten, ein Umdenken: Das Team setzte die beiden Kanäle erstmals in Beziehung zueinander. Die Wissenschaftler machten sich dabei zunutze, dass sich Töne wellenförmig fortbewegen und aufgrund des zeitlichen Unterschieds jedes der beiden Ohren in einer anderen Phase dieser Welle erreichen. Die Phasenverschiebung, die beide Kanäle im Zusammenspiel miteinander haben, ist also das Puzzleteil, das es jetzt endlich ermöglicht, menschliches Richtungshören physiologisch korrekt vorherzusagen. „Wir haben da schon eine ziemlich harte Nuss geknackt“, fasst Dietz die Arbeit der vergangenen Jahre zusammen.
Sogar besser als das alte Modell funktioniert der Oldenburger Ansatz, wenn es darum geht, die Wirkung von zwei verschiedenen Störgeräuschen realistisch in die Vorhersage einzubeziehen, was das alte Modell bisher vernachlässigt hatte. Das hat Eurich in einer weiteren Publikation dargelegt. Jetzt will der Doktorand erforschen, wie er das neue Modell dafür einsetzen kann, das räumliche Hören mit Hörgeräten zu verbessern. Es soll voraussagen, auf welche Teile der Geräuschkulisse bei der Verstärkung nicht verzichtet werden darf, damit ein Hörgeräteträger keine Qualitätseinbußen bemerkt.
Kontakt:
Publikationen: