Hochschulzeitung UNI-INFO
Kontakt
Hochschulzeitung UNI-INFO

Thema
Bürgerliches Familienmodell nicht mehr einziges Ideal
Jutta Limbach über die gesellschaftliche Einstellung zu berufstätigen
Müttern und zur Langlebigkeit eines Vorurteils
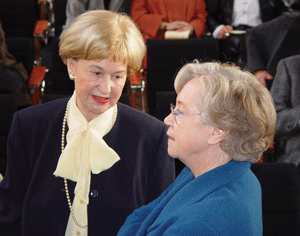 |
Zur Emeritierung der Familiensoziologin Prof. Dr. Rosemarie Nave-Herz
(links) am 5. Februar 2003 hielt die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungs-gerichts
und heutige Präsidentin des Goethe-Instituts Inter Nationes, Prof.
Dr. Jutta Limbach (rechts), den Festvortrag zum Thema „Eine Zukunft
ohne Kinder?“ Nachfolgend Auszüge aus der vielbeachteten Rede.
Eine Zukunft ohne Kinder? Sterben die Deutschen aus? Zum Glück ist
es noch nicht so weit. Doch sprechen unsere Statistiken eine deutliche
Sprache, was die Geburten-freudigkeit angeht. Seit dem Jahre 1972 werden
jedes Jahr weniger Kinder geboren als Menschen sterben. Die durchschnittliche
Lebenserwartung in Deutschland nimmt weiter zu. Ein heute geborener Junge
hat die Chance rund 74 Jahre, ein heute geborenes Mädchen hat die
Chance rund 80 Jahre alt zu werden. Schon heute lässt sich der Altersaufbau
der Bevölkerung nicht mehr mit der grafischen Darstellungsform einer
Alterspyramide beschreiben. Die grafische Darstellungsform entspricht
eher einer „zerzausten Tanne“ (Flaskämper), einer Tanne,
die im unteren Drittel des Stammes schmal ist und erst dann ausfächert,
allerdings ohne spitz zuzulaufen.
Aber nicht nur die Altersstruktur unserer Gesellschaft hat sich verändert,
sondern auch die Größe der Familien. Der Trend zur Kleinfamilie
wird immer stärker. Der Anteil der Einkindfamilien liegt inzwischen
bei rund 50 Prozent. 37 Prozent der Familien haben zwei Kinder, während
nur in 12,6 Prozent aller Familien drei oder mehr Kinder zu Hause sind.
Die bemerkenswerte Abnahme der Kinderzahl gefährdet nicht nur den
so genannten Generationenvertrag, weil die wenigen Kinder später
nicht die Renten der immer älter und damit zahlreicher werdenden
Ruheständler aufzubringen vermögen. Die geringe Kinderzahl beeinträchtigt
die Kinder bereits in ihrer Kindheit und Jugendzeit, weil ihnen die Erfahrung
entgeht, Geschwister zu haben. Das ist aus vielen Gründen für
ihre Entwicklung nachteilig...
Karriere und Familie schließen sich nicht aus
Statt in kulturpessimistischem Geiste die sinkende Geburtenrate
zu bejammern und sie mit den Luxusbedürfnissen, dem Egoismus und
dem Selbstverwirklichungswahn irregeleiteter Frauen zu erklären,
ist die nüchterne Analyse gefragt. Diese verspricht eher Anregung
für Abhilfe als das Verklären der Mutterrolle und das Verteufeln
des individuellen Lebensstils. Denn auffällt, dass, wenn man Jugendliche
befragt, sie stets den Wunsch äußern, später Kinder haben
zu wollen.
Das hat die jüngste, just veröffentlichte Shell-Jugendstudie
bestätigt. Die Jugendlichen haben danach nicht nur Freude an der
Familie. Übrigens wohnen rund drei Viertel der Jugendlichen zwischen
12 und 25 Jahren noch bei der Herkunftsfamilie. Über zwei Drittel
der befragten Jugendlichen wollen später eigene Kinder. Doch Kinderwunsch
und Kinderkriegen sind zweierlei: Das Durchschnittsalter, in dem heute
Frauen in der Bundesrepublik Kinder bekommen, steigt immer mehr an.
Der Wandel der Mutterrolle
Die Auffassung von der Mutterrolle hat sich bei den jüngeren
Generationen grundlegend gewandelt, begünstigt auch durch den Umstand,
dass die gegenwärtige Jugend Ideologien weitgehend abhold ist. Das
bürgerliche Familienmodell mit der nicht erwerbstätigen Mutter
gilt ihnen nicht mehr als einziges Ideal. Wenngleich sich dessen Anhänger
gern lautstark zu Wort melden, wenn die Arbeit knapp wird. Seit der Studentenbewegung
und der Neuen Frauenbewegung, der verbesserten Ausbildung der Frauen und
ihrem veränderten Selbstbewusstsein vollzieht sich allmählich
ein Wandel im gesellschaftlichen Denken (Nave-Herz). Die jungen Menschen
von heute sind vielfach bereits von berufstätigen Müttern und
Vätern aufgezogen worden und können aus eigener Erfahrung darüber
urteilen, ob sie dadurch verwahrlost sind, wie es trotz entgegenstehender
wissenschaftlicher Erkenntnisse immer wieder einmal gern behauptet wird.
Die Folgen der mütterlichen Erwerbstätigkeit auf die Sozialisation
der Kinder sind international bestens erforscht worden. Ein negativer
Zusammenhang zwischen beiden Variablen, also Sozialisationsdefizite, sind
bei den Kindern nicht festgestellt worden. Hier ist ein vielschichtiges
Wirkungsgefüge zu beachten, in dem eine Reihe von Faktoren, wie etwa
der Grund der mütterlichen Erwerbstätigkeit, das Qualifikationsniveau
und die Berufszufriedenheit der Mutter zusammenwirken. Nicht zu vergessen
auch die Qualität der Ersatzbetreuung. Aber auch familiäre Faktoren
wie die Kinderzahl und das emotionale Klima in der Familie spielen eine
wichtige Rolle.
Entsprechendes gilt übrigens für die Frau, die sich ganztags
der Familienarbeit widmet. Auch hier spielt ihre Zufriedenheit mit dieser
Tätigkeit eine wichtige Rolle, nämlich ob sie diese Entscheidung
frei und im Einvernehmen mit ihrem Mann getroffen hat oder ob ihr angesichts
der hohen Arbeitslosigkeit oder wegen der fehlenden Berufsausbildung keine
andere Wahl geblieben ist.
Laut der Sozialisationsforschung ist das eigentliche Problem von Kleinkindern
nicht die mütterliche Berufstätigkeit selbst, sondern die gesellschaftliche
Einstellung dazu. Das zählebige und bei schlechter Arbeitsmarktlage
besonders gepflegte Vorurteil, erwerbstätige Mütter hätten
eher verwahrloste Kinder, macht die jungen Mütter unsicher und erzeugt
Angst- und Schuldgefühle. Diese Ambivalenzkonflikte beeinträchtigen
den Umgang von Mutter und Kind und damit dessen Entwicklung empfindlicher
als die Berufstätigkeit selbst. Die Zählebigkeit dieses Vorurteils
über die schädliche Auswirkung der Berufstätigkeit von
Müttern im Kleinkindalter ist vor allem darauf zurückzuführen,
dass die Öffentlichkeit von den Forschungsergebnissen noch immer
kaum Kenntnis nimmt.
Empirische Untersuchungen zeigen, so resümiert die Soziologin Rosemarie
Nave-Herz, „dass diese Mutterideologie zusammen mit den fehlenden
Infrastruktureinrichtungen im Westen zu einer hohen Kinderlosigkeit geführt
hat und unter Umständen weiter führen wird. Denn immer mehr
Mütter schieben ihren Kinderwunsch wegen ihres hohen Berufsengagements
und der gleichzeitig gegebenen Vereinbarkeitsproblematik von Beruf und
Familie hinaus, in der Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt eine
Lösung ihres Problems finden zu können, bis es dann aber zu
spät ist“, und aus der vorläufigen Kinderlosigkeit eine
unfreiwillige, lebenslange wird.
Die unflexible Arbeitszeitorganisation und das Fehlen ausreichender Möglichkeiten
der Kinderbetreuung sind Fakten, die nach wie vor die Frauen im Arbeitsleben
benachteiligen...
Neue Väter braucht das Land
Wie steht es mit dem Wandel der Vaterrolle? Wir sollten uns durch
den jüngst in den Medien berichteten Kampf zweier unverheirateter
Väter vor dem Bundesverfassungsgericht nicht darüber hinwegtäuschen
lassen, dass die neuen Väter eine Minderheit sind, die statistisch
nicht ins Gewicht fällt. Sobald aus einem Paar eine Familie wird,
spielen sich geradezu zwangsläufig die alten Verhaltensweisen ein.
Selbst wenn die Männer die Berufstätigkeit ihrer Frau uneingeschränkt
unterstützen, liegen die Familien- und Hausarbeit eindeutig im Verantwortungsbereich
der Frau. Immer wieder zeigt sich, dass viele junge Männer in der
Theorie ungemein egalitär denken, doch in der Praxis verfahren sie
nach dem Motto: „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.“
Die fortschrittliche Haltung der Männer gegenüber dem anderen
Geschlecht reicht nur soweit, wie Frauen keine Mütter sind. Das offenbart
sich bei dem Erziehungsurlaub, den sowohl Mütter als auch Väter
in Anspruch nehmen können. Rund 97,7 Prozent aller Erziehungsberechtigten
nehmen Erziehungsgeld in Anspruch. Allerdings sind 98,5 Prozent davon
Mütter. Dagegen machen lediglich rund 1 Prozent der Väter von
der Möglichkeit Gebrauch, sich frühen Vaterfreuden zu widmen.
Lediglich 0,5 Prozent der jungen Eltern haben das im Wechsel gemacht.
Der Frust der neuen Väter
Die verschwindend geringe Zahl von Vätern, die das Abenteuer „Küche und Kinder“ wagen, hat - wie die im Auftrag des Bundesfamilienministeriums durchgeführte Hausmannsstudie ergeben hat - mit großem Frust zu kämpfen. Die Hausmänner fühlen sich „isoliert und unausgefüllt“. Vor allem die ungewohnte Hausarbeit scheint an ihren Nerven zu zerren. So hat einer der befragten Männer geklagt: „Wenn man, sagen wir mal, freitags irgendwo saubergemacht hat, liegt nächste Woche zur selben Zeit an derselben Stelle der gleiche Dreck... .“ Auch der Ausweg dieses vereinsamten Hausmannes, Zuflucht in einer Müttergruppe zu finden, hat sich als Fehlschlag erwiesen. So klagt er weiter: „Irgendwie habe ich mich da draußen gefühlt, weil ich halt ein Mann bin.“ - Übrigens wollte sich keiner der befragten Männer auf Dauer ausschließlich der Familie widmen.
Eine Zukunft mit Kindern
Wer sich eine Zukunft mit Kindern wünscht, darf weder in
das kulturpessimistische Gejammer über das Ende der Familie verfallen
noch die Familienarbeit verklären. Das dürfte zu nichts führen.
Dass Kinder nicht nur Verantwortung und Sorge, sondern auch Bereicherung,
Freude und Glück bedeuten, weiß selbst jeder junge Mensch.
Die wichtigste Forderung deutscher Frauen an die Politiker lautet nach
einer repräsentativen Umfrage des Emnid-Instituts: „Schafft
endlich eine Infrastruktur, die es uns ermöglicht, Familie und Beruf
unter einen Hut zu bringen.“ Auf die Frage „Angenommen Sie wären
Bundeskanzlerin, was würden Sie als erstes ändern?“ gaben
91 Prozent der Befragten an, sie würden mehr Jobs mit Gleit- und
Teilzeit schaffen. 88 Prozent würden ausreichend Krippen-, Hort-
und Kindergartenplätze bereitstellen. Bei den 14- bis 29-Jährigen
waren es sogar 92 Prozent. Die Tatsache allerdings überrascht, dass
sich nur 45 Prozent für die Ganztagsschule als Regelschule einsetzen
würde.
In anderen Ländern ist ein Teil dieser Forderungen bereits Realität.
Nehmen wir das Beispiel Frankreich, wo 99 Prozent der Kinder zwischen
drei und sechs Jahren eine vorschulische Betreuung erhalten und die Bezahlung
von Tagesmüttern von der Steuer abgesetzt werden kann. Es gibt fast
nur Ganztagsschulen, die den Kindern ein Mittagessen anbieten. Die Folge:
ein hoher Beschäftigungsanteil von Müttern (60 Prozent) und
die höchste Geburtenrate der EU mit 1,8 Kindern pro Frau. In Deutschland
liegt sie dagegen bei 1,2 Kindern pro Frau.
Die Kinderfrage ist die Frauenfrage
Es geht mir nicht darum, ein überkommenes einseitiges Familienbild, nämlich das der Hausfrauenehe, durch ein anderes gleichermaßen einseitiges Ideal der Berufstätigenehe zu ersetzen. Es geht darum, dass die den Frauen und Männern eingeräumte Wahlfreiheit nicht eine trügerische bleibt, bei der sich die Frauen nur aussuchen können, welches Problem sie haben wollen ... .
Je mehr Kinder,je mehr Glück
Auch in Zukunft werden sich nicht alle in gleicher Weise verhalten.
Es wird nach wie vor männliche wie weibliche Vorlieben geben. Denken
wir an die Fußballleidenschaft der Männer oder die Freude der
Frauen an der schönen Literatur. Die Bundeswehr wird weiterhin von
Männern dominiert sein. Auch mögen vorzugsweise Frauen in den
Krippen, den Kindergärten oder in den Familien die kleinen Kinder
betreuen. Unsere Zukunftshoffnung ist die, dass die Aufgabenteilung in
Beruf und Familie nicht das Produkt sozialer und wirtschaftlicher Zwänge
ist, sondern das Resultat einer freien Wahl.
Sie mögen meinen, ich hätte im zweiten Teil meines Vortrags
zuviel von den Frauen und Müttern statt von den Kindern gesprochen.
Aber nach wie vor, meine Herren und Damen, ist die Frauenfrage die Kinderfrage
und die Kinderfrage damit die Frauenfrage.
Wer eine Zukunft mit Kindern erstrebt, darf nicht verbal am „demographischen
Abgrund“ entlang turnen und Kinder nur funktional als künftige
Rentenzahler in den Blick nehmen. Er muss Martin Luthers Einsicht hochhalten:
„Je mehr Kinder, je mehr Glück!“
Rosemarie Nave-Herz
Mit Prof. Dr. Dr. h.c. Rosemarie Nave-Herz wurde zum Ende des
Wintersemesters 02/03 eine der renommiertesten deutschen Familiensoziologinnen
emeritiert, die mit nur kurzen Unterbrechungen seit 1967 zur Oldenburger
Soziologie gehörte. Nave-Herz studierte Soziologie, Wirtschaftswissenschaften
und Germanistik an der Universität Köln, legte 1959 die
Diplom-Prüfung ab und promovierte 1963 mit einer Arbeit über
die Elternschule.
Ihre wissenschaftliche Laufbahn begann die Soziologin 1965 als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
in Berlin. 1967 wechselte sie als Dozentin nach Oldenburg, wurde
aber schon drei Jahre später auf einen Lehrstuhl für Soziologie
an der Universität Köln berufen. Doch das war ein Zwischenspiel.
1973 kehrte sie zurück und besetzte die Professur für
Soziologie mit den Schwerpunkten Familie, Jugend und Freizeit an
der gerade gegründeten Universität Oldenburg. Mehrere
Universitäten hätten sie danach gern in ihren Lehrkörper
aufgenommen. Sie aber blieb Oldenburg treu. In fast 30 wissenschaftlichen
Gremien war sie tätig: Unter anderem gehörte sie dem Vorstand
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie an, war Vorsitzende
der DFG-Senatskommission Frauenforschung und Vizepräsidentin
des Committee on Family Research der International Sociological
Association. Als Gastprofessorin lehrte sie 1985 an der University
of Sussex/England und wurde 1986 Nachfolgerin von Rita Süssmuth
als Leiterin des Niedersächsischen Instituts für Frau
und Gesellschaft.
Auch in der Politik war der Rat von Nave-Herz oft gefragt: Sie war
Mitglied zahlreicher Beratergremien - unter anderem Vorsitzende
des wissenschaftlichen Beirats für Familienpolitik des Bundesministers
für Familie und Jugend und Mitglied der Sachverständigenkommission
für den fünften Familienbericht. Gewürdigt wurden
ihre Leistungen vielfach. 1995 verlieh ihr die Philosophische Fakultät
der Technischen Universität Chemnitz die Ehrendoktorwürde,
und 2000 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz.
Zur Ruhe wird sich die große Wissenschaftlerin auch nach der
Emeritierung nicht setzen. Forschungsprojekte sollen weiterlaufen
und ihre Mitarbeit in Kommissionen und Beiräten ist nach wie
vor gefragt.


