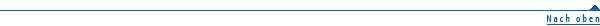Hochschulzeitung UNI-INFO
Kontakt
Hochschulzeitung UNI-INFO
Thema
Den Einzelnen herausfordern
Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ erstmals in Niedersachsen
Im November nahmen 31 SchülerInnen mit Einwanderungsgeschichte am Schülercampus „Mehr Migranten werden Lehrer“ an der Universität Oldenburg teil. Während der Orientierungsveranstaltung lernten sie die Vielfalt des Lehrerberufs kennen, sprachen mit PraktikerInnen über Berufswege, Aufstiegsmöglichkeiten oder Fächerwahl und hospitierten an Schulen. Dabei bekamen sie Gelegenheit zum Austausch mit ExpertInnen, insbesondere mit LehrerInnen und Lehramtsstudierenden, die selbst eine Einwanderungsgeschichte haben.
Vizepräsidentin Prof. Dr. Gunilla Budde, die den Schülercampus eröffnete, betonte, dass LehrerInnen mit Migrationshintergrund eindrucksvolle Rollenvorbilder für die SchülerInnen seien. „Sie führen ihnen tagtäglich vor Augen: Wir haben es geschafft. Das kannst du auch! Solche ‚role models‘ sind Brückenbauer und Herzstück einer interkulturellen Schulentwicklung“, sagte Budde.
„Der Schülercampus ‚Mehr Migranten werden Lehrer‘ gibt Orientierung und ermutigt zum Lehramtsstudium“, unterstrich Prof. Dr. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in Hamburg, bei der Auftaktveranstaltung. „Wir haben dieses Projekt initiiert, weil Deutschlands Schulen mehr Lehrer mit Zuwanderungsgeschichte brauchen. Unser Impuls will den Einzelnen herausfordern, um die Schule und damit auch die Gesellschaft zu bereichern.“
Für Dr. Stefan Porwol, Staatssekretär im Niedersächsischen Kultusministerium, hat die Veranstaltung „Vorbildcharakter, weil sie vor Augen führt, wie eine gelungene Integrationspolitik funktioniert“.
Das Projekt Schülercampus zielt auf ein Grundproblem allgemeinbildender Schulen in Deutschland: Fast jeder dritte Schüler ist nichtdeutscher Herkunft. In manchen Großstadt-Schulen liegt der Anteil über 60 Prozent, in einzelnen Klassen bis zu 90 Prozent. LehrerInnen mit Einwanderungsgeschichte bilden noch die Ausnahme – deutschlandweit sind es nur zwei Prozent.
Das bundesweit einmalige Orientierungsangebot gab es erstmals 2008 in Hamburg. Inzwischen findet „Mehr Migranten werden Lehrer“ jährlich auch in Nordrhein-Westfalen und Bay-ern statt. Der Schülercampus ist eine Initiative der ZEIT-Stiftung und wurde in Oldenburg in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium und der Universität veranstaltet. Förderer waren die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung, die TUI Stiftung und die EWE Stiftung. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration sowie dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. (cdb)
„Migration gehört zum Leben“
Schülercampus: Auszüge aus der Begrüßungsrede von Vizepräsidentin
Gunilla Budde / „Mehr Mittel in unser Bildungssystem investieren“
 "Menschen mit Migrationshintergrund“ oder „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“: Man ringt ganz offensichtlich darum, Ihre Biographie, liebe Schülerinnen und Schüler, auf einen Begriff zu bringen. Unabhängig davon, dass dies ihr Leben auf nur einen Aspekt verkürzt, der noch dazu einigen vielleicht gar nicht mal der wichtigste ist, wird in der augenblicklichen Diskussion häufig suggeriert, es hier mit einem relativ neuen Phänomen zu tun haben. Ich bin nicht nur Vizepräsidentin dieser Universität, sondern auch Historikerin. Deshalb muss ich auch über diese semantischen Bemühungen lächeln, zumindest ein bisschen. Denn: Migration im Lebenslauf ist keineswegs neu. Historisch gesehen gehörte sie zum Leben des Menschen, mal freiwillig, mal gezwungen, gleichsam mit dazu. Und dies seit langem. (…)
"Menschen mit Migrationshintergrund“ oder „Menschen mit Einwanderungsgeschichte“: Man ringt ganz offensichtlich darum, Ihre Biographie, liebe Schülerinnen und Schüler, auf einen Begriff zu bringen. Unabhängig davon, dass dies ihr Leben auf nur einen Aspekt verkürzt, der noch dazu einigen vielleicht gar nicht mal der wichtigste ist, wird in der augenblicklichen Diskussion häufig suggeriert, es hier mit einem relativ neuen Phänomen zu tun haben. Ich bin nicht nur Vizepräsidentin dieser Universität, sondern auch Historikerin. Deshalb muss ich auch über diese semantischen Bemühungen lächeln, zumindest ein bisschen. Denn: Migration im Lebenslauf ist keineswegs neu. Historisch gesehen gehörte sie zum Leben des Menschen, mal freiwillig, mal gezwungen, gleichsam mit dazu. Und dies seit langem. (…)
Ich möchte mit diesen Bemerkungen keine Probleme weg- oder schönreden – sondern unsere heutige Sichtweise relativieren. Was in der Vergangenheit sicherlich nicht unproblematisch war, aber zur Selbstverständlichkeit gehörte, kann in der Zukunft ebenso zur Normalbiographie werden.
Natürlich gibt es auch in Deutschland Probleme, die gemeinhin unter dem Stichwort „Integration“ zusammengefasst werden und die in jüngster Zeit keineswegs immer konstruktiv, geschweige denn glücklich in Stil und Impetus, lautstarker als zuvor in der Öffentlichkeit diskutiert wurden. (…)
Gleichwohl, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, steht es mit der Integration in Deutschland bei weitem besser als gemeinhin angenommen. So kommt das aktuelle „Jahresgutachten Einwanderungsgesellschaft 2010“ zu dem Schluss:
„Im internationalen Vergleich ist ‚die Integration‘ in Deutschland keineswegs gescheitert. Sie ist vielmehr in vielen empirisch fassbaren Bereichen durchaus zufriedenstellend oder sogar gut gelungen. Zudem stehen beide Seiten der Einwanderungsgesellschaft – das heißt die Menschen mit und ohne Migrationshintergrund – „den Anforderungen von Zuwanderung und Integration pragmatisch und zuversichtlich gegenüber“. Grundlage des sehr fundierten Gutachtens ist eine ausführliche Befragung von 5.600 Personen nach dem Zufalls-prinzip, davon 80 Prozent Personen mit Migrations- und 20 Prozent ohne Migrationshintergrund.
Bezeichnenderweise wird über dieses Gutachten in der Öffentlichkeit wenig geredet, sind seine Ergebnisse nur wenigen bekannt. Auch hier bestätigt sich mal wieder eine historische Regel: Schlechte Nachrichten rütteln auf, gute geraten darüber häufig in den Schatten.
Trotz seiner insgesamt deutlich positiven Bewertung verschweigt das Gutachten aber auch nicht die Problemfelder der Integration: „Die Unzulänglichkeiten des Bildungssystems“, heißt es dort, „treffen Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund wegen ihrer integrationsspezifischen Zusatzbelastungen in besonderem Maße.“ (…) Damit ist nicht zuletzt unser Schulsystem gemeint. Ein Schulsystem, das viel, vielleicht zu viel Einsatz der Eltern voraussetzt – einen Einsatz, den Eltern mit Einwanderungsgeschichte in der Regel nicht leisten können – aber sehr viele ohne Einwanderungsgeschichte eben auch nicht.
Wollen wir hier wirklich grundlegend etwas ändern, so werden wir nicht umhin kommen, weit mehr Mittel als bisher in unser Bildungssystem zu investieren. Und zwar mit gezielter Förderung der bislang besonders Benachteiligten. Das sind vor allem die Kindergärten. Auch die Grund-, Förder- und Hauptschulen, und hier wieder besonders die an sozialen Brennpunkten. Bildung und Integration sind nicht umsonst zu haben. Sie kosten Geld. Viel Geld.
Vereinfachungen und spürbare Trennlinienvon Rudolf Leiprecht*
|