Kontakt
Befriedigende Arbeit in einstürzenden Neubauten
Ein autobiographischer Bericht

2009, im Hörsaal 1 der Universität Oldenburg
August 2022
Inhalt
1. Elternhaus
1.1 Geburt und Flucht
1.2 Meine Mutter
1.3 Mein Vater
2. Kindheit und Schule
2.1 Zwillinge
2.2 Kindheit und Jugendzeit
2.3 Schule und Abitur
2.4 Berufswahl
3. Erstes Studium und Schuldienst
3.1 Kirchliche Hochschule Bethel
3.2 Pädagogische Hochschule Oldenburg
3.3 Erstes Lehramtsexamen
3.4 Volksschullehrer im Ammerland
3.5 Zweites Lehramtsexamen
4. Promotionsstudium und Arbeit für den Kollegschulversuch
4.1 Just in time – Studium an der Freien Universität Berlin (West)
4.2 Westfälische Wilhelmsuniversität Münster – Magister Artium
4.3 Mein Doktorvater Herwig Blankertz
4.4 Promotion
4.5 Chaotischer Lehrbetrieb
4.6 Kollegschulversuch Nordrhein-Westfalen
5. Heirat – vier Kinder – Goldene Hochzeit
6. Hochschullehrer an der Carl von Ossietzky Universität
6.1 Eine Professur in Oldenburg – Was willst du mehr!?
6.2 Dienstantritt und Lehrstuhlausstattung
6.3 Modellversuch zur Einphasigen Lehrerbildung (ELAB)
6.4 Projektstudium
6.5 Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit und der Lehrtätigkeit
6.6 Praktikumsbetreuung
6.7 Dekanat
6.8 Promotionsbetreuungen
6.9 Promotions-Reisekader
6.10 Prüfungstätigkeiten
6.11 Hochschulbeauftragter für Prüfungsangelegenheiten
7. Kooperationen
7.1 Zentrum für pädagogische Berufspraxis
7.2 Arbeitsstelle Schulreform
7.3 Forschungswerkstatt Lehrer*innenbildung
7.4 Oldenburger Teamforschung – BLK-Modellversuch
7.5 DDR-Kontakte und Wiedervereinigung
7.6 Graduiertenkolleg Didaktische Rekonstruktion
7.7 Dozent*innenschulung für die IG-Metall
7.8 Masterstudiengang Schulmanagement an der Uni Kiel
7.9 LABORSCHUL-Beirat
7.10 CORNELSEN-Beirat
8. Veröffentlichungen
8.1 Liaison mit dem Cornelsen-Verlag
8.2 Longseller
8.3 Beifang
8.4 Zeichnungen
9. Sechzigster Geburtstag 2001 und Emeritierung 2009
Fazit und Nachtrag
Vorweg: Ich habe fast mein gesamtes Berufsleben in Einstürzenden Neubauten[1] zugebracht:
- Kaum war ich im Jahr 1972 Angestellter des Nordrhein-westfälischen Kultusministeriums geworden, um am Aufbau des Kollegschulversuchs NW mitzuarbeiten, wurde dieser Versuch von der damaligen Landesregierung NW aufgrund eines Vetos der mitregierenden FDP in seinem wichtigsten Element, nämlich der Fusion von gymnasialer Oberstufe und Berufsbildender Schule, gekappt. Wir Wissenschaftler*innen haben dagegen protestiert, aber ohne Erfolg.
- Kaum hatte ich 1975 eine Professur an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg erhalten und mich verpflichtet, mich aktiv am Aufbau des Modellversuchs zur Einphasigen Lehrerbildung zu beteiligen, wurde dieser Modellversuch von der 1976 neu gewählten CDU-Landesregierung wieder abgeblasen.
- Kaum hatte ich 1989 als damaliger Dekan des Fachbereichs 1 meine langjährigen Kontakte zu Lothar Klingberg (Potsdam) und Edgar Rausch (Leipzig) für eine Kooperationsvereinbarung mit der Clara-Zetkin-Hochschule in Leipzig genutzt, wurde die DDR und kurz darauf auch die Pädagogische Hochschule Leipzig abgewickelt.
- Kaum hatten wir nach dem Abbruch des Modellversuchs „Einphasigkeit“ an der Uni Oldenburg den Lehrbetrieb auf die (noch halbwegs sinnvolle) zweiphasige Lehramts-Prüfungsordnung umgestellt, wurde im Zuge des Bologna-Prozesses das Bachelor/Master-Modell eingeführt und alles, was wir aufgebaut hatten, erneut durcheinander gewirbelt.[2]
So ist das Leben: Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich mit der Zeit daran gewöhnt habe, nicht allzu viel Herzblut in die Organisationsstruktur des eigenen Arbeitsplatzes zu stecken und mehr darauf zu achten, auch unter widrigen Bedingungen Sinn in der eigenen Arbeit zu entdecken. Meine Oldenburger Kollegin Astrid Kaiser hat vor 20 Jahren angemerkt, dies sei eine unpolitische Haltung. Deshalb will ich mich genauer ausdrücken: Ich halte den Streit um die richtige Organisationsform der Lehrer*innenbildung weiterhin für unverzichtbar und bin immer noch entschiedener Verfechter des mit frühen Praxisphasen verknüpften Konzepts der Einphasigen Lehrerbildung. Aber das Scheitern großer Projekte ist für mich kein Grund zu schmollen oder gar den Arbeitseinsatz zu drosseln. Gerade unter widrigen Umständen ist es im alltäglichen Lehrbetreib umso wichtiger, als Hochschullehrer eine Vorbildrolle wahrzunehmen, den Studierenden konkret zu zeigen, wie man gut unterrichtet und sie beim Aufbau einer humanen Lehrer*innenhaltung zu unterstützen. Darum habe ich mich in meinen Lehrveranstaltungen bemüht. Mehr dazu im Abschnitt 6!
Textgenese: Die erste Fassung dieses Textes ist 2006 auf Bitten meines schon lange emeritierten Oldenburger Kollegen Bernhard Möller für eine Aufsatzsammlung mit autobiografischen Texten Oldenburger Erziehungswissenschaftler*innen verfasst worden.[3] Diese alte Fassung ist nun im Umfang vervierfacht und um viele Fotos und Zeichnungen ergänzt worden. Deshalb der neue Untertitel: „Ein autobiografischer Bericht“.
Absichten: Dieser Text ist kein Beitrag zur erziehungswissenschaftlichen Positionsbestimmung, schon gar nicht zur Theoriebildung. Das habe ich an anderen Stellen zu tun versucht.[4] Der Text ist – trotz Untertitel – keine Autobiografie, sondern so etwas wie ein Rechenschaftsbericht über inzwischen 58 Jahre beruflicher Tätigkeit, zunächst an der Volksschule Ocholt (im Oldenburger Land), dann an der Freien Universität Berlin und der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seit 1975 bis heute an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Im Text sind auch einige eher persönliche Hintergrundinformationen zu meiner Berufslaufbahn enthalten, die ich hier erstmals veröffentliche. In einem Lehrbuch hätten sie nichts zu suchen!
Erinnerungsvermögen: Ich schreibe diesen Bericht aus dem Gedächtnis auf. Ich habe nur hin und wieder in alten Unterlagen und Dokumenten gestöbert, um Daten und Namen zu kontrollieren. Bei solch einem Vorgehen können Fehler entstehen. Das weiß man als früherer Geschichtsstudent aus den Analysen zur oral history. Ich bitte um Verständnis.
Fotos und Scans: Ich habe viele Zeichnungen, Fotos, Gästebuchauszüge u.a. m. in den Text integriert, um die Schilderungen plastischer werden zu lassen. Wenn sich jemand wiedererkennt, bitte ich ihn im Nachhinein um das, was im Verlagswesen heutzutage model release genannt wird.
Ein Hauch von Narzissmus: Eine deutliche Ichbezogenheit ist bei einem solchen Selbstbericht kaum zu vermeiden. Man berichtet besonders gern über Menschen, die in der eigenen Disziplin einen bekannten Namen haben, und sonnt sich dann darin, mit ihnen zu tun gehabt zu haben. Die vielen kleinen erfreulichen und manchmal auch irritierenden Erfahrungen am Rande eines langen Berufslebens werden dann übergangen, auch weil ich sie oftmals lange vergessen habe. Ich bitte um Verständnis! Dennoch habe ich, als dieser Text fertig war, gestaunt, ja ich war geradezu erschrocken, wie riesig die Anzahl netter und kooperativer Menschen war und ist, mit denen ich in 57 Berufsjahren zusammengearbeitet habe.[5]
Oldenburg, den
1. August 2022

1. Elternhaus
1.1 Geburt und Flucht
Ich wurde am 2. Oktober 1941 in Lauenburg/ Pommern als viertes von sechs Kindern geboren.  Ich bin der um zehn Minuten jüngere Zwilling zu meinem Bruder Meinert Meyer. Unsere Mutter hat uns erklärt, wie man uns unterscheiden kann: Meinerts Gesicht läuft ein wenig spitz zu (wie die Spitze im Großbuchstaben M), Hilberts Gesicht verläuft parallel (wie der Großbuchstabe H).
Ich bin der um zehn Minuten jüngere Zwilling zu meinem Bruder Meinert Meyer. Unsere Mutter hat uns erklärt, wie man uns unterscheiden kann: Meinerts Gesicht läuft ein wenig spitz zu (wie die Spitze im Großbuchstaben M), Hilberts Gesicht verläuft parallel (wie der Großbuchstabe H).
Meine Eltern stammten aus dem Land Oldenburg (mein Vater aus Wilhelmshaven, meine Mutter aus Delmenhorst). So bin ich eher zufällig ganz im Nordosten des damaligen Deutschlands geboren worden. Erst vor 35 Jahren, als ich das erste Mal eine Biografie des polnischen jüdischen Pädagogen Janus Korczak las und auf der Karte nachschaute, wo Treblinka[6] liegt, stellte ich mit Entsetzen fest, wie nah dran an den Vernichtungslagern wir damals gelebt haben. Meine Mutter erzählte uns, dass sie von ihrem Schwager Georg-Heinz (Theologiestudent; damals Soldat in der Nähe von Minsk, vermisst in Russland seit 1944) gehört hatte, dass „im Osten schlimme Dinge passieren“. Genaueres habe ihr Schwager aber auch nicht mitgeteilt.
Anfang Februar 1945 – mein Vater war als Marineleutnant in Wilhelmshaven stationiert – flüchtete meine Mutter mit den damals geborenen vier Kindern (zwei ältere Brüder, Berend und Dierk, Zwillingsbruder Meinert und ich) sowie mit meinen Großeltern vor der heranrückenden Sowjetarmee in den Westen. Eine ausführliche Schilderung findet sich in der HOMEPAGE-Datei „Unsere Fluchtgeschichte“.
Meine Mutter hat aufgeschrieben, wie anstrengend und risikoreich für uns alle die Flucht war.[7] Wir Zwillinge wurden an zwei langen Lederleinen festgebunden, um nicht im Gedrängel der Zugabteile verloren zu gehen. Wir sind aber nie in Todesgefahr gewesen und fühlten uns offensichtlich gut behütet. Bis heute träume ich aber hin und wieder davon, dass ich mich in einem Zug befinde und meine Reisegefährten oder das Gepäck verloren habe oder auf dem Bahnhof herumrenne und nicht den richtigen Bahnsteig finde. Zumeist hält der Zug nicht dort, wo er halten soll, oder er kommt überhaupt nicht an.
1.2 Meine Mutter
Meine Mutter Erna Meyer, geb. Günther, wurde 1912 in Delmenhorst (westlich von Bremen) geboren. Sie starb im Jahr 2000 in Westerstede. Unsere Mutter war die älteste von vier Schwestern. Ihr Vater Ernst Günther war Lehrer in Delmenhorst im Stadtteil Düsternort. Er war ein begeisterter Turner und Sänger. Er hat ein Liederbuch herausgegeben, das bei meinem Bruder Meinert in Münster gelandet ist. Er starb 1918 im Ersten Weltkrieg, als meine Mutter 6 Jahre alt war, an der Front in Frankreich (in der Nähe von Verdun).
Mein Vater Friedrich Meyer war in der Familie für den Außendienst zuständig. Unsere Mutter hatte im Innendienst das Sagen – zumindest in jenen Jahren, in denen ich dies als Jugendlicher und junger Erwachsener bewusst wahrnehmen konnte. Wir Kinder kamen mit allen Problemen und Wünschen, die es gab, zuerst zu unserer Mutter und besprachen, was davon an den Vater weiter gesagt wurde – so lernten wir, halbwegs diplomatisch zu agieren.
Unsere Mutter hat an der Delmenhorster Oberrealschule Abitur gemacht. Sie wollte eigentlich Medizin studieren, aber das war zwischen den beiden Weltkriegen in ihrer Familie aus finanziellen Gründen undenkbar. Sie war sicherlich das, was man heute eine starke Frau nennt.  Sie wurde immer wieder von Bekannten und Verwandten gebeten, schwierige Lagen zu klären. Alle Geschwister und auch ich haben sie sehr geschätzt und geachtet, während mit dem Vater dieser oder jener Konflikt ausgetragen wurde.
Sie wurde immer wieder von Bekannten und Verwandten gebeten, schwierige Lagen zu klären. Alle Geschwister und auch ich haben sie sehr geschätzt und geachtet, während mit dem Vater dieser oder jener Konflikt ausgetragen wurde.
Erna hat es zeitlebens bedauert, keine eigene Berufsausbildung gehabt zu haben. Jeder jungen Frau, die zu uns ins Haus kam, sagte sie: „… aber du machst auf jeden Fall eine Berufsausbildung!“
Malerei: Unsere Mutter war seit ihrer Kindheit begeisterte Laienmalerin und hat es dabei weit gebracht. Zwei Kostproben: ein Selbstbildnis aus dem Jahr 1986 und ein Aquarell von 1981, das einen schneebedeckten Weg im Thalenbusch in unserem Heimatort Westerstede zeigt. Wir rissen uns um Ernas Bilder, die sie großzügig verschenkte.

Als Erna am 7.7.1992 ihren 80. Geburtstag feierte und wegen Osteoporose schon im Rollstuhl saß, haben wir sechs Kinder alle unsere Erna-Bilder, die wir von ihr geschenkt bekommen, oder schlicht gemopst hatten zusammengetragen und im Haus der Evangelischen Kirche Westerstede eine private Ausstellung organisiert. Ernas Bilder haben wir dann um die von uns Kindern und Enkelkindern (13 an der Zahl) hergestellten Aquarelle, Ölbilder von Bruder Meinert, die Radierungen von Dierk, die Pferdezeichnungen von Schwester Dörte, den Silberschmuck von Enkelin Eltje, die aus dänischem Strandgutholz gebauten Schiffsmodelle von Hilbert (Abschnitt 5) ergänzt.



Drei Fotos von dieser Ausstellung: links Bruder Meinert mit zwei eigenen Ölbildern, in der Mitte Erna, geschoben von Enkel Berend, rechts eine von unserem Sohn Tiedo selbst gebastelte „Silvester-Rakete“, die dann zum Abschluss der Feierei gezündet wurde.
Erna hat uns Kinder immer wieder gezeichnet, einmal auch den Kopf meines Bruders Dierk in Ton modelliert. Hier eine Zeichnung von Hilbert aus dem Jahr 1948. Ich war damals 7 Jahre alt. 
Sicherlich lag es an diesem Zeichen- und Maltalent unserer Mutter, dass ich – wie alle anderen fünf Meyer-Kinder auch – immer gerne selbst gezeichnet habe, auch wenn ich es lange nicht so weit gebracht habe (siehe Abschnitt 8.4). Unsere Mutter hat uns einfach die Angst genommen, etwas zu Papier zu bringen.
1.3 Mein Vater
Mein Vater Friedrich Georg Meyer, genannt Friedel, wurde 1904 in Wilhelmshaven als ältester von drei Kindern geboren. Er starb 1974 in Westerstede.
Mein Großvater väterlicherseits war Georg Meyer, unehelicher Sohn des Kaufmanns Georg Orth[8] aus Apen bei Westerstede. Er war zunächst Matrose auf einem in Wilhelmshaven stationierten Torpedoboot, mit dem er während des Boxeraufstandes 1897/98 bis nach China in die deutsche Kolonie Tsingtau (heute Qingdao) und nach Hiroshima in Japan gekommen ist. Nach einigen Jahren wurde er zum sogenannten Decksoffizier befördert (eine Aufstiegsposition zwischen Matrosen und Offizieren). Er heiratete meine Großmutter Wilhelmine, geb. Schreiber, aus dem Dorf Barnstorf, die bis zu ihrem 92. Lebensjahr bei uns in Westerstede im Haus wohnte. Am Ende des Ersten Weltkriegs wurde die Reichs-Kriegsmarine aufgelöst und mein Opa entlassen. Danach hat er keine Arbeit mehr gefunden, war also Frührentner. Als im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf die Stadt Wilhelmshaven immer stärker wurden, zogen meine Großeltern Georg und Wilhelmine zu uns nach Lauenburg/Pommern.
Seminarausbildung und Promotion: Mein Vater war der erste in seiner Familie, der in Wilhelmshaven zur Oberrealschule geschickt wurde, dann aber sitzen blieb[9] und an das Lehrerseminar in Varel bei Oldenburg wechselte.[10] Nach dem Abschluss wurde er Volksschullehrer an mehreren Schulen im Landkreis Ammerland. In zwei Anläufen hat er dann in Bonn ein Studium in Erziehungswissenschaft absolviert. (Der Seminarabschluss wurde als Hochschulreife anerkannt.) 1936 ist er von Erich Rothacker (1881-1965) promoviert worden – ein bekannter Philosoph, der zunächst den Nationalsozialismus begrüßt hatte, dann aber seinem Selbstzeugnis nach in die innere Emigration ging. Nach der Befreiung vom Faschismus hat u.a. Jürgen Habermas bei Rothacker promoviert. Ich habe Vaters Dissertation gelesen und war dann eher beruhigt, dass der Text über die Didaktik Georg Kerschensteiners – zumindest in meiner Wahrnehmung – keine offen nationalsozialistischen Passagen enthält.
Nazi: Mein Vater war laut seiner Personalakte seit 1933 Mitglied der NSDAP, er hat aber, abgesehen von dem allerdings gravierenden Amt des NS-Führungsoffiziers 6 Monate vor dem Ende des Faschismus (s.u.) niemals einen Posten in der Partei gehabt. Uns gegenüber hat er nicht darüber gesprochen. Wir haben auch nicht nachgefragt, aber wir kannten ja die Fotos mit dem NSDAP-Parteiabzeichen aus dem Familienfotoalbum. Vaters jüngerer Bruder Georg-Heinz, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, war aktives Mitglied der Bekennenden Kirche. Mein Vater hat uns nie erzählt, ob sie sich gestritten haben.
PH Lauenburg/Pommern: Im Jahr 1936 heirateten meine Eltern. 1938 erhielt mein Vater eine Dozentenstelle an der Pädagogischen „Grenzlandhochschule“ in Lauenburg/Pommern, wohin die junge Familie mit meinem gerade geborenen ältesten Bruder Berend zog.  Die neu gegründete Lauenburger Hochschule wurde von den Nationalsozialisten gezielt zur ideologischen Erschließung und Beherrschung des „Ostraumes“ gegründet. Die erste Riege der Dozenten – allesamt stramme Nazis – hatte sich nach wenigen Jahren so zerstritten, dass sie sich in einer Dienstbesprechung gegenseitig mit vorgehaltener Pistole bedrohten. Daraufhin beschloss der Reichserziehungsminister Bernhard Rust, einen erheblichen Teil des Personals auszutauschen.
Die neu gegründete Lauenburger Hochschule wurde von den Nationalsozialisten gezielt zur ideologischen Erschließung und Beherrschung des „Ostraumes“ gegründet. Die erste Riege der Dozenten – allesamt stramme Nazis – hatte sich nach wenigen Jahren so zerstritten, dass sie sich in einer Dienstbesprechung gegenseitig mit vorgehaltener Pistole bedrohten. Daraufhin beschloss der Reichserziehungsminister Bernhard Rust, einen erheblichen Teil des Personals auszutauschen.
- rechts auf dem Foto aus dem Jahr 1942: mein Vater, die älteren Brüder Berend und Dierk und die Zwillinge. (Who is who?)
Mit dieser zweiten, nicht völlig, aber doch ein wenig „entideologisierten“ Dozenten-Riege kamen u.a. der spätere Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau Wolfgang Sucker (1905-1968) als Religionspädagoge, der spätere Delmenhorster Musiklehrer Werner Figur und auch mein Vater als Dozent für Schulpädagogik nach Lauenburg.[11]
Soldat: Schon bald nach der Ernennung zum Dozenten in Lauenburg folgte 1939 die Einberufung zum Militärdienst, den mein Vater der Familientradition folgend bei der Marine in Wilhelmshaven absolvierte. Er brachte es bis zum Leutnant. Die letzten zwei Kriegsjahre war er Adjutant beim Standortkommandanten der Kriegsmarine in Wilhelmshaven. Dort wurde er im September 1944 zum NS-Führungsoffizier ernannt.[12] Daraus kann man schließen, dass er auch damals noch ein bekennender Nazi war. Mit Kriegsende wurde mein Vater Kriegsgefangener der Britischen Besatzungsarmee und im ehemaligen Konzentrationslager Esterwegen (in dem wenige Jahre vorher Carl von Ossietzky gequält worden war) interniert. 1946 kam er aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Damals habe ich ihn als Fünfjähriger das erste Mal bewusst wahrgenommen.
Nachkriegskarriere: Nach der „Entnazifizierung“[13] wurde mein Vater zunächst Studienrat an der Oberschule Westerstede (ohne Erstes oder Zweites Gymnasiallehrerexamen), dann im Jahr 1950 Schulrat des Landkreises Ammerland und 1956 Professor für Schulpädagogik an der Pädagogischen Hochschule für Landwirtschaftslehrer in Wilhelmshaven. Er ist also einer der vielen, die trotz früher NSDAP-Mitgliedschaft in Westdeutschland Karriere machen konnten. Er hat sich dann auch glaubwürdig für den Aufbau demokratischer Strukturen in meiner Heimatgemeinde Westerstede eingesetzt, z.B. als Elternratsvorsitzender des Gymnasiums, als Mitglied des Gemeindekirchenrats und der Synode der Evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg.

Friedel Meyer und Herwig Blankertz (auf meiner Hochzeitsfeier 1969)
PH für Landwirtschaftslehrer: Die Wilhelmshavener Hochschule für Landwirtschaftslehrer wurde 1973/74 aufgelöst und die Planstelle meines Vaters, der inzwischen der Rektor geworden war, wurde im niedersächsischen Landeshaushalt in den Stellenplan der in Gründung befindlichen Universität Oldenburg überführt. Und genau diese Stelle „Schulpädagogik“ habe ich von 1975 bis 2009 inne gehabt. Als ich mich in Oldenburg bewarb, wusste ich noch nichts von diesem Zufall. Es wäre mir auch peinlich gewesen. Schließlich gibt es an Universitäten keine Erbhöfe. Aber als der Ruf da war, hat mir mein damals schon schwer krebskranker Vater gesagt, dass er diese Entdeckung gemacht hatte. Erst ein Dutzend Jahre später habe ich anderen das erste Mal von diesem Zufall erzählt.
Ein erstes Fazit: Ich komme aus einem bürgerlichen akademischen Elternhaus, leider bei meinem Vater mit ungenügender Distanz zur Nazi-Diktatur. Meine Mutter war skeptischer, aber eine starke Frau, die uns acht Kinder bestens großgezogen hat. Die Tatsache, dass mein Vater Hochschullehrer war, hat mir, so glaube ich, die Berufsplanung erleichtert: Eine Promotion war für mich nichts Unerreichbares. Sie schien mit entsprechendem Arbeitseinsatz „machbar“ zu sein. Und ich hatte keinen überflüssigen Respekt vor Professorentiteln! Zumindest sagte mir mein Doktorvater Herwig Blankertz später einmal, dass er genau wegen dieses ganz selbstverständlichen und niemals lobedienerischen Umgangs mit ihm gerne mit mir zusammenarbeitete.

1949: Erna zeichnet Hilbert /siebeneinhalb Jahre alt)
2. Kindheit und Schule
2.1 Zwillinge
Ich habe, wie eingangs angemerkt, einen eineiigen Zwillingsbruder, Meinert Meyer (1941-2018), der – welch Zufall – ebenfalls Professor für Schulpädagogik geworden ist und nach einer ersten Professur in Halle (Saale) am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg lehrte.

1943 – Mutter Erna, Berend, Dierk und die Zwillinge
Als wir noch Kinder waren, hat uns der Zwillingsstatus eher gestört. Meinert betonte gern, dass er 10 Minuten älter als ich sei. Ich habe ihm dann etwas von Jakob und Esau erzählt (oder mir zumindest vorgenommen, es ihm zu erzählen). Unsere Lehrer*nnen konntem uns – bis auf ein, zwei Ausnahmen – nicht unterscheiden. Deshalb erhielten wir am Gymnasium grundsätzlich nur in jenen Fächern, in denen schriftliche Leistungen abgerufen wurden, unterschiedliche Noten. Bis zum Abitur saßen wir in derselben Klasse. Jede Klassenfahrt und jede Ferienreise machten wir gemeinsam. Viele Geburtstagsgeschenke mussten wir uns teilen, was ich gegenüber meinen älteren Geschwistern, die nicht teilen mussten, als ungerecht empfand. Deshalb waren wir beide froh, als wir nach dem Abitur endlich unsere eigenen Wege gehen konnten.
Ähnlichkeit: Wir Zwillinge sahen uns als Kinder extrem ähnlich. Unsere Mutter hatte niemals Probleme – auch nicht, als die Lauenburger Krankenschwestern zwei Tage nach der Geburt unsere Namensbändchen austauschten, um zu testen, ob meine Mutter dies merkt. Aber mein Vater hatte manchmal, wenn wir ein wenig weiter weg waren, Schwierigkeiten, uns zu unterscheiden. Dann rief er „Meinert/Hilbert herkommen!“
Verwechslungsspiele: Als wir unsere eigenen Wege gegangen waren und dann fünfzehn Jahre später beruflich wieder aufeinander stießen, haben wir den Zwillingsstatus sehr genossen. Mein Bruder übernahm 1975 bei Herwig Blankertz meinen Arbeitsplatz in der Wissenschaftlichen Begleitung Kollegschule in Münster – noch jahrelang trafen wir Menschen, die den Personenwechsel nicht bemerkt hatten. Wurde mein Bruder von einem Kollegen angesprochen, der ihn mit mir verwechselt, so pflegte er zu sagen: „Ich kenne Sie nicht. Aber ich kenne Ihr Problem.“ Und umgekehrt, als mein Duzfreund Jürgen Lüthje, damals Präsident der Uni Hamburg und früher Kanzler der Uni Oldenburg, Bruder Meinert im Intercity traf, fragte er: „Bist Du’s – oder sind Sie’s?“
Zeitgleich in Banff und Canada? Im Dezember 1979 musste ich kurzfristig für den Vizerektor unserer Universität, Friedel Busch, einspringen und hatte das Vergnügen, gemeinsam mit Detlef Spindler, Uli Steinbrink und Klaus Winter eine Dienstreise in die Rocky Mountains in den kanadischen Kurort Banff zu machen, wo von dem Norweger Per Dalin eine internationale Tagung zur Lehrerbildung organisiert wurde. Meine einzige Aufgabe bestand darin, einen 15minütigen Vortrag über die Oldenburger Einphasige Lehrerbildung zu halten. Die Entscheidung fiel so kurzfristig, dass ich die nächste Vorlesungssitzung (zum Thema „Schülerorientierte Unterrichtsplanung“) nicht mehr absagen konnte. Deshalb ist mein Bruder eingesprungen, hat sich meine Klamotten angezogen und ist in die Oldenburger Aula marschiert, ohne sich zu outen, auch wenn er, wie er mir hinterher sagte, am liebsten hier und dort in den von mir vorbereiteten Vorlesungstext die Anmerkung hätte einbringen wollen: „Hier irrt mein Bruder!“ Bis auf meine jüngste Schwester, die damals in Oldenburg studierte, und vier oder fünf Studierende, die wussten, dass ich einen Zwillingsbruder habe, hat niemand den Schwindel bemerkt. Eigentlich wollte mein Bruder ihn am Ende der Sitzung öffentlich machen. Aber dazu kam er nicht mehr, weil alle Studierenden nach 90 Minuten so ruckartig die Aula verließen, dass er seinen Vorsatz nicht mehr umsetzte. Noch Jahre später bin ich gefragt worden, ob es wirklich stimmt, dass ich mich in dieser Sitzung habe vertreten lassen. Eine Studentin kam eine Woche später zu mir und sagte, ich sei ihr gleich so merkwürdig vorgekommen und sie hätte sich überlegt, ob ich Ehekrach gehabt hätte. In der Vorlesung saß ein Student, der Mitglied der rechtsradikalen NPD war. Er stellte gern Fragen und nervte damit. Wir hatten meinen Bruder nicht auf dieses Risiko hingewiesen. Deshalb ging er zur Überraschung der übrigen Studierenden sehr betulich auf seine auch in dieser Sitzung kommende Frage ein.
Hamburg: Umgekehrt habe ich meinen Bruder vertreten, als er 1996 Dekan an der Uni Hamburg war und die Examensentlassungsfeier für die Lehrämter gestalten musste. Ich hatte Forschungssemester und war zeitlich flexibel. Da hat sich mein Bruder vor Beginn der Veranstaltung in den Kulissen versteckt, ich habe die Feier mit einer Ansprache über die Erwartungen an den Lehrerberuf eröffnet und auf ein abgesprochenes Wort hin kam mein Bruder dazu und wir haben den Vortrag als Dialogreferat zu Ende geführt.
Wir haben nicht den Eindruck, durch den Zwillingsstatus eine mangelhafte Ichstärke erworben zu haben.[14] Das Gegenteil scheint uns wahrscheinlicher. Wir tickten eben sehr ähnlich, auch wenn es bis zum Schluss dieses oder jenes Konkurrenzspielchen gab, unter dem aber nicht Meinert, sondern allenfalls seine Frau Christel gelitten hat, weil sie – als Einzelkind großgeworden – diese Spielchen als sehr anstrengend empfand.
Im Jahr 2017 erkrankte mein Bruder an einem Gehirntumor und starb daran Ende 2018.
2.2 Kindheit und Jugendzeit
Ich lebte vom 3. bis zum 19. Lebensjahr in der Ortschaft Westerstede/Landkreis Ammerland, zunächst in einem für Flüchtlinge frei gemachten Schützenvereins-Haus,  dann ab 1954 in einem neu mit Flüchtlings-Darlehen gebauten kleinen Haus am Ortsrand von Westerstede: Melmenkamp 21. Wir Zwillinge hatten unser Zimmer ganz oben unter dem Dach – eigentlich gar kein Zimmer, sondern ein Verschlag mit schrägen Wänden und einem Bettgestell mit Matratze auf dem Fußboden. Ein eigenes Zimmer bekam ich 1962 das erste Mal als Student.
dann ab 1954 in einem neu mit Flüchtlings-Darlehen gebauten kleinen Haus am Ortsrand von Westerstede: Melmenkamp 21. Wir Zwillinge hatten unser Zimmer ganz oben unter dem Dach – eigentlich gar kein Zimmer, sondern ein Verschlag mit schrägen Wänden und einem Bettgestell mit Matratze auf dem Fußboden. Ein eigenes Zimmer bekam ich 1962 das erste Mal als Student.
Zehn „Kinder“: Wir waren ein großer Haushalt. Neben den schon genannten drei älteren Brüdern wurden zwei jüngere Schwestern, Detje und Dörte, 1950 und 1953 in Westerstede geboren. Zusätzlich zu diesen fünf Geschwistern lebten zwei Pflegekinder in unserer Familie, die ungefähr so alt waren wie ich: Hans-Wilhelm Meyer und Dieter Siemen.  Außerdem lebte während meiner gesamten Jugendzeit meine Großmutter Wilhelmine Meyer bei uns. Sie ließ sich pausenlos von meiner Mutter bedienen, statt im großen Haushalt mit anzupacken, sie nörgelte gern und machte ihrer Schwiegertochter das Leben schwer. Später habe ich das so kommentiert: „Wir waren zu Hause mit 10 Kindern – die Oma zählte doppelt, weil sie so ziegig war.“
Außerdem lebte während meiner gesamten Jugendzeit meine Großmutter Wilhelmine Meyer bei uns. Sie ließ sich pausenlos von meiner Mutter bedienen, statt im großen Haushalt mit anzupacken, sie nörgelte gern und machte ihrer Schwiegertochter das Leben schwer. Später habe ich das so kommentiert: „Wir waren zu Hause mit 10 Kindern – die Oma zählte doppelt, weil sie so ziegig war.“
- Foto rechts: Hilbert als Fünfzehnjähriger im Schwimmbad
Schwimmband: Eine große Rolle spielte für uns Kinder im Sommer die Badeanstalt. Meinert und ich hatten schon mit 4 Jahren begonnen, schwimmen zu lernen und mit 5 Jahren das Freischwimmerabzeichen gemacht. Meine Eltern hielten dies für wichtig, weil wir direkt neben einem Schwimmbad wohnten, das keinen Zaun besaß, so dass die Gefahr bestand, als Nichtschwimmer beim Spielen zu ertrinken. Spezialität der Zwillingsbrüder war Turmspringen. Wir brachten es bis zum Auerbach-Salto. Ich konnte auch ohne Mühe 50 bis 60 Meter tauchen. Als Jugendlicher kraulte ich oftmals hintereinander 500 Meter (10 Bahnen) oder 1000 Meter (20 Bahnen) im großen Becken des Westersteder Schwimmbads. Wir genossen es, als Grundschulkinder bei der Großmutter, die damals noch in Wilhelmshaven wohnte, im Marinebad vom 10-Meter-Turm zu springen. Wir hatten sie vorher vorsichtshalber gar nicht gefragt, ob wir das dürfen.
Offenes Haus: Wir hatten in Westerstede am Melmenkamp 21 ein offenes Haus. Viele Freunde und Mitschüler*innen gingen bei uns aus und ein. Insbesondere die Fahrschüler*innen der Oberschule übernachteten oft bei uns, wenn sie nach abendlichen Schulveranstaltungen nicht mehr nach Hause kommen konnten. Auch deshalb wurde die Haustür bei uns nicht abgeschlossen. Es konnte ja abends noch jemand kommen, der eine Ecke zum Schlafen sucht – und dann mussten nicht alle aufgeweckt werden. Fast jedes Jahr hatten wir ausländische Gäste – Schüler und Schülerinnen aus England oder aus Frankreich, die mit uns den Unterricht besuchten. In den Ferien machten wir dann Gegenbesuche. So war ich dreimal bei einer Familie in Straßburg, die, wie ich erst beim zweiten Besuch erfuhr, vor 1945 in der Résistance aktiv gegen die Nazi-Diktatur eingetreten war.
Reisen: Meine Eltern haben niemals Urlaub gemacht – weder mit uns 8 Kindern noch allein. Dazu reichte das Geld nicht. Aber es gab Alternativen. In der 8. Klasse machten Meinert und ich mit der ev. Jugendgruppe der Gemeinde Westerstede und Pastor Hans von Seggern eine großartige Fahrradfahrt durch Holland und in der zehnten Klasse eine Besuchsfahrt nach Dover, London und Cardiff (Wales). Ich bin ab der 10. Klasse oft in den Sommerferien und auch noch als Student mit meinem Zwillingsbruder per Anhalter durch ganz Europa getrampt: in die Niederlande, nach Frankreich, in die Schweiz und bis nach Griechenland. Ich wähnte mich im Reich der Freiheit und habe jede dieser Reisen genossen.[15]
2.3 Schule und Abitur
Von 1948 bis 1952 besuchte ich die erste bis vierte Klasse der Volksschule Westerstede (später in Brakenhoffschule umbenannt), von 1952 bis 1961 dann die fünfte bis dreizehnte Klasse der Oberschule Westerstede (später in Gymnasium Westerstede umbenannt). Es gab damals noch Aufnahmeprüfungen für die Oberschule. Die prüfenden Lehrer*innen informierten am Schluss der Prüfungswoche meine Eltern, dass es sinnvoller wäre, die Zwillinge noch ein Jahr warten zu lassen – sie seien noch nicht reif für ein Gymnasium. Meine Eltern haben sich aber nicht an diesen Ratschlag gehalten. Unsere Noten waren aber während der ganzen Schulzeit nicht sonderlich gut. Ich bekam in der Mittelstufe zweimal den sogenannten blauen Brief, da „Nichtversetzung droht“. Nur in Sport hatte ich im Abitur ein sehr gut, in Mathe und Latein dafür ein 4 minus. Sehr gute Noten habe ich – bis auf die Sportnote – das erste Mal am Ende des PH-Studiums erhalten.
Meine Lehrer*innen: Sie nervten mich eher, als dass ich von ihnen beeindruckt war. Ihre Didaktik und Methodik war in vielerlei Hinsicht von Vorgestern. Aber das habe ich erst verstanden, als ich selbst ein Lehramt studierte. Die jüngeren Lehrer[16] gaben sich mehr Mühe, hatten aber auch damals schon ihre liebe Not, uns zu disziplinieren. Noch im Zeugnis der 11. Klasse stand unter „Bemerkungen“ für die Zwillinge gleichlautend: „Neigt zu undisziplinierter Mitarbeit“. Meine Mutter fragte dann nach, was damit gemeint sei. Die Antwort: „Die Zwillinge liefern aktive Beiträge, aber sie quatschen dazwischen und halten sich nicht an die vereinbarten Spielregeln.“
Ich hatte einen einzigen Lehrer, den ich voll und ganz respektierte, obwohl ich bei ihm schlechte Noten bekam: Oberstudienrat Hennig, Lehrer für Latein und Geschichte. Erst sehr viel später habe ich erfahren, dass er vor dem Zweiten Weltkrieg bei Theodor Litt in Leipzig studiert hatte, dort eigentlich Assistent werden soltle, dann aber durch die Kriegsereignisse nicht mehr dazu gekommen ist und auch nicht bei ihm promovieren konnte.
Polit-AG: Mit einigen Mitschülern (es waren nur Jungen) gründeten wir eine „Polit-AG“ und beschäftigten uns – erstmalig an der Schule – mit der Nazi-Geschichte des Ortes und mit dem Verbleib der bis 1933/45 in Westerstede wohnenden Juden. Diese Arbeit war mit ein Anlass dafür, dass ich gleich nach dem Ersten Examen in die GEW und in die SPD eintrat. In der GEW bin ich bis heute gelieben. Die SPD habe ich in der Studentenrevolte wieder verlassen – genauer: ich habe die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen eingestellt. 1982 bin ich wieder eingetreten. Seither besitze ich zwei SPD-Parteibücher.
Hobbies: Als ich in der 6. und 7. Klasse war, erhielt ich einen Kosmos-Experimentierkasten „Chemie“. Das hat mich fasziniert. Am liebsten habe ich mit Kaliumpermanganat experimentiert, weil man damit sehr gut Knallgas machen konnte.
Ich hatte ein Aquarium. Man kaufte dafür in Oldenburg Guppies, Schwertträger und Skalare. Hin und wieder zog ich zu einem der Tümpel in der Nachbarschaft, um mit einem Käscher Wasserflöhe als Lebendfutter zu fischen. Oder ich fuhr mit dem Rad zum „Möhlenbült“, einem 4 km entfernten Teich, der vor 100 Jahren für den Bau der Eisenbahn von Ocholt nach Westerstede ausgehoben worden war. Dort fing ich einen Salamander, eine Köcherfliege oder einen Stichling samt Nest und Eiern, aus denen dann zu Hause die Jungtiere schlüpften, die ich zum Füttern der Skalare nutzen konnte. Meine Spezialität war später das Aufziehen von Kampffischen. Sie haben eine spezielle Technik, ihre Brut in Schaumnestern, die sie mit ihrer eigenen Spucke bauen, groß zu ziehen.
Abitur: Zu Ostern 1961 habe ich am Gymnasium Westerstede mit 27 Mitschüler*innen die Abiturprüfung gemacht. In Latein stand ich zwischen 5 und 4, habe es dann aber doch noch geschafft.

Die Abiturklasse, sprachlicher Zweig: in der zweiten Reihe, erster von rechts in der zweiten Reihe: Hilbert; dritter von rechts: Meinert
2.4 Berufswahl
Ich stamme, wie oben bereits erläutert, aus einer Lehrerfamilie. Mein Großvater mütterlicherseits und mein Vater waren Lehrer. Vier meiner Geschwister wurden Lehrer*innen. Ich habe eine Ehefrau und drei Schwägerinnen, die Lehrerinnen sind. Wir hätten zusammen das Kollegium einer mittelgroßen Grundschule bilden können. 14 der 28 Mitschüler*innen meiner Abiturklasse wurden Lehrerin/Lehrer. Die Entscheidung für den Lehrerberuf lag also nahe. Sie fiel schon in der 10. Klasse. Vorher das übliche: Erst wollte ich Förster, dann Chemiker werden. Als der Chemieunterricht in der Schule begann, erlosch mein Interesse an Chemie ruckartig. Ein Motivationsverstärker für die Entscheidung für den Lehrerberuf war wohl der Tatbestand, dass ich nach der Konfirmation in der Ev. Kirche Westerstede sogenannter Kindergottesdiensthelfer geworden war und jeden Sonntag eine biblische Geschichte erzählen und derweil zwanzig zappelige sechs- bis zwölfjährige Knaben ruhig halten musste. Das hat mir Spaß gemacht. Nachwirkungen finden sich im Abschnitt „Geschichtenerzählen“ in meinem Buch „Unterrichtsmethoden“.
Meine Berufsentscheidung hat nie gewackelt, ich erinnere mich aber, mir schon vor dem Abitur vorgenommen zu haben, nach dem PH-Studium noch einmal weiter zu studieren. Die Parallelen meines Berufswegs zu dem meines Vaters sind also offensichtlich.
3. Erstes Studium und Schuldienst
3.1 Kirchliche Hochschule Bethel
Vom Sommersemester 1961 bis zum Wintersemester 1961/62 studierte ich an der mit 200 Studierenden sehr kleinen Kirchlichen Hochschule in Bethel bei Bielefeld und machte dort das von einer staatlichen Kommission abgenommene Graecum. Das Bethel-Studium war ein Angebot unseres Vaters, das drei von uns Kindern wahrgenommen haben. Er begründete diese zusätzlichen Kosten bei knappen Gehalt so: „Am Gymnasium in Westerstede habt Ihr nicht lernen können, was hartes Arbeiten ist. Aber wenn Ihr das Graecum in Bethel bei dem Griechischprofessor Krämer absolviert habt, wisst Ihr das erste Mal, was richtiges Arbeiten ist.“ Unser Vater hatte übrigens Recht! Der Prof hat uns, wenn auch auf liebenswürdige Art und Weise, schikaniert, weil er den Ehrgeiz hatte, mit uns Studierenden nach 11 Monaten den gleichen Leistungsstand zu erreichen, bis zu dem das altsprachliche Gymnasium in Bielefeld in 8 Jahren kam. Deshalb mussten wir als letzte Vorklausur an der Hochschule die Abi-Klausur dieses Gymnasiums schaffen. Meine Graecum-Note war „befriedigend“.
Das Jahr in Bethel hat eine Horizonterweiterung gebracht, auch weil von uns Studierenden erwartet wurde, dass wir an den Wochenenden in den Krankenhäusern von Bethel aushalfen, um die dort tätigen Diakone zu entlasten. Seither habe ich keinerlei Berührungsängste gegenüber Epilektikern oder Menschen, die an Schizophrenie erkrankt sind. Und die im Graecum erworbenen Sprachkenntnisse helfen, mit den vielen erziehungswissenschaftlichen Fachbegriffen griechischen Ursprungs umzugehen.
PH Bielefeld: Zeitgleich war ich als Gasthörer an der Pädagogischen Hochschule Bielefeld eingeschrieben. Meine Kommiliton*innen in Bethel fanden es merkwürdig, dass ich Griechisch lernte, um Volksschullehrer zu werden. Als ich mich mal verplapperte und sagte, ich könnte mir vorstellen, später an einer Pädagogischen Hochschule zu lehren, haben sie mich ausgelacht. So habe ich gelernt, dass „Professor“ kein mitteilungsfähiger Berufswunsch ist, habe aber nie die Idee aufgegeben, dass es sich um einen attraktiven Arbeitsplatz handle.
3.2 Pädagogische Hochschule Oldenburg
Vom Sommersemester 1962 bis zum Sommersemester 1964 studierte ich fünf Semester lang an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg. Ich hatte in Oldenburg zwei Semester des Nebenstudiums an der PH Bielefeld angerechnet bekommen, allerdings wurden keine Prüfungsteile erlassen. Deshalb habe ich nur eines der Anrechnungssemester genutzt.
Hauptfach und Nebenfächer: Ich hatte als Hauptfach Deutsch gewählt. Die vier Nebenfächer waren Geschichte, Mathematik, Ev. Religion und Englisch. Deutsch hatte ich gewählt, weil ich Brecht-Fan war. Leider hörte für meinen Dozenten, Prof. Hans Lüschen, die ernst zu nehmende Literatur – und nur die wurde behandelt – bei Hugo von Hofmannsthal auf. Ich wusste ja nicht, dass Lüschen sich zum Stefan-George-Kreis zählte – ich hatte auch nie von diesem Kreis gehört. Die vier Nebenfächer mussten mit jeweils zwei Scheinen, also 4 Semesterwochenstunden, abgedeckt werden – besser als gar nichts!

Der Lehrbetrieb startete 1962 noch in dem 1846 gebauten früheren „Lehrerseminar“ in der Peterstraße – übrigens mit einer sehr schönen holzvertäfelten Aula, die bis heute erhalten ist. Nach zwei Semestern zogen wir dann allesamt in den gerade fertig gewordenen Neubau in der Ammerländer Heerstraße um – heute der älteste Gebäudeteil der Universität an der Ammerländer Heerstraße.
Landschulpraktikum: Besonders beeinflusst hat mich in meiner beruflichen Entwicklung das sogenannte Landschulpraktikum, das ich in den Sommersemesterferien 1962 mit dem Kommilitonen Reinhard Riedel, der erst kurz zuvor als Spätaussiedler aus Ostpreußen nach Oldenburg gekommen war, absolviert habe. Wir wurden der zweiklassigen Volksschule in Arle/Ostfriesland zugewiesen. Unsere Mentorin war Ellen Riggert. Sie war die Hauptlehrerin.

Das Schulgebäude in Arle – hinter den drei Fenstern im Dachgeschoss der Werkraum, in dem wir zwei Studenten für 6 Wochen kostenfrei untergebracht wurden.
Wir kamen in die Oberklasse mit den Jahrgängen 5 bis 8, die von Ellen unterrichtet wurde. Das heißt, dass wir jeden Tag Abteilungsunterricht machen mussten und so von Beginn an lernten, was Innere Differenzierung ist.
Ellen vertrat und realisierte in ihrem Unterricht reformpädagogische Ideen, die sie in ihrem Studium an der PH Hannover kennen gelernt hatte. Ich war beeindruckt von der Methodenkompetenz der „Landkinder“. Sie waren z.B. im Religionsunterricht in der Lage,  unterschiedliche Redaktionsschichten eines Gleichnisses oder einer Wundergeschichte zu identifizieren – und das mehrheitlich auf Ostfriesisch Platt (das ich mit meinen oldenburgischen Platt-Kenntnissen nur teilweise verstand). Ellen bläute uns ein: „Als Lehrer musst du lernen, deine Waffen im Spind zu lassen.“ Leider hat sie sich später, als sie Grundschulrektorin in Oldenburg geworden war, von diesem Grundsatz verabschiedet.
unterschiedliche Redaktionsschichten eines Gleichnisses oder einer Wundergeschichte zu identifizieren – und das mehrheitlich auf Ostfriesisch Platt (das ich mit meinen oldenburgischen Platt-Kenntnissen nur teilweise verstand). Ellen bläute uns ein: „Als Lehrer musst du lernen, deine Waffen im Spind zu lassen.“ Leider hat sie sich später, als sie Grundschulrektorin in Oldenburg geworden war, von diesem Grundsatz verabschiedet.
- Verabschiedung aus dem Landschulpraktikum mit Ellen Riggert
Jeden Nachmittag (!) mussten wir im Praktikum bei der Lehrerin antanzen und blieben dort in aller Regel für 3 Stunden. Zuerst gab es eine Tasse Tee (gut ostfriesisch mit Kluntjes und Sahne). Danach wurde jede am Vormittag gehaltene Stunde gründlich ausgewertet, dann wurden die Unterrrichtsstunden des nächsten Tages besprochen. Regelmäßig schrieb Ellen in ihre Stundenprotokolle: „Lehrer stört den Unterricht!“ Und sie hatte fast immer recht. Wir waren einfach noch zu ungeschickt und hatten noch nicht kapiert, wie selbstständig diese ostfriesischen Landkinder bereits waren und wieviele Arbeitstechniken sie bereits beherrschten.
Stadtschulpraktikum: Nach dem Wintersemester 1962/63 war für mich das Stadtschulpraktikum dran. Da nahm ich allen Mut zusammen und fragte meine Kommilitonin Christa Konukiewitz, ob wir das Praktikum gemeinsam machen wollten. Ich kannte sie seit der ersten Semesterwoche 1962,  weil wir zufällig in derselben Gruppe für das sog. Donnerstagspraktikum eingeteilt worden waren, bei dem wir einen Vormittag jeder Woche in der Schule waren. Ich war mir gar nicht sicher, ob Christa ja sagen würde – aber sie tat‘s.
weil wir zufällig in derselben Gruppe für das sog. Donnerstagspraktikum eingeteilt worden waren, bei dem wir einen Vormittag jeder Woche in der Schule waren. Ich war mir gar nicht sicher, ob Christa ja sagen würde – aber sie tat‘s.
- Auf dem Foto bringt Christa unseren Schüler*innen die Handzeichen für das Singen einer Tonleiter bei.
Das Praktikum fand in der Klasse 2 b der Grundschule Haarentor (Oldenburg) statt, gleich neben der PH. Unsere Mentorin Gudrun Heise war, wie schon Ellen Riggert im Landschulpraktikum, ganz prima. Sie hat uns gezeigt, wie anspruchsvoll eine angemessene Gestaltung des Rechtschreib- und Rechenlehrgangs in der Grundschule ist. Seither vertrete ich die Position, dass der Unterricht im Lese-Schreib- und Rechenlehrgang didaktisch anspruchsvoller als jeder Leistungskurs in einer gymnasialen Oberstufe ist.
Zeitgleich zum Praktikum hatte ich dann wegen der angerechneten Semester schon die ersten Fachprüfungen in den Nebenfächern Englisch und Geschichte. Das war mühsam, aber es hat funktioniert, auch weil Christa so tolerant war, einige eigentlich von mir zu erledigende Arbeiten zu übernehmen. Unser Betreuer und Zensierer im Stadtschulpraktikum war der Musikdidaktiker Ulrich Günther. Christa bekam die Note „gut“, ich ein Befriedigend“.
Evangelische Studentengemeinde (ESG): Christa und ich engagierten uns in der Studentengemeinde. Bis auf den AStA und den SHB gab es damals keine weitere studentische Organisation, in der man sich hätte engagieren können. Mitmachen in der ESG lag bei uns nahe, weil Christa eine Pastorentochter ist und weil ich ebenfalls aus einem evangelisch geprägten Elternhaus komme. Wir waren beide, aber nicht zeitgleich, studentische Sprecher der ESG – ein Job, dessen Arbeitsaufwand sich in Grenzen hielt. Es gab in der ESG Freizeiten im Blockhaus Ahlhorn, aber auch eine enge Kooperation mit der Reformierten ev. Kirche Ostfriesland und – natürlich – im Winter eine Kohlfahrt. Einen starken Eindruck hinterließ der frisch eingesetzte erste Oldenburger Studentenpfarrer Peter Wagner aus Detmold, mit dem wir zeitlebens befreundet geblieben sind. Er stand klar links – sowohl politisch als auch theologisch. Bei ihm hörten wir etwas über Dorothee Sölle und er erklärte uns, warum er Pazifist war.
Exkursion zur FDJ nach Ost-Berlin: Lebhaft habe ich in Erinnerung, dass der damalige AStA der PH Oldenburg im Jahr 1963 – also kurz nach dem Mauerbau – eine Einladung der FDJ-Hochschulgruppe der Humboldt-Universität in Ostberlin/DDR annahm.[17] Meine zukünftige Frau und ich konnten mitfahren. Werner Loch und Hans-Jochen Gamm, damals die Inhaber der zwei Professuren für Allgemeine Pädagogik an unserer Hochschule, waren auch dabei. Hans Jochen Gamm hielt einen mutigen Vortrag zur Schulpolitik.[18] Wir schauten uns die Polytechnische Bildung in einem Elektrobetrieb an und diskutierten mit den Lehrer*innen. In der Humboldt-Uni Unter den Linden diskutierten wir mit einer relativ großen Runde von Pädagogikprofessoren über Erziehungsfragen. Ein Professor verstieg sich zu der Forderung, dass angesichts der feindlichen Haltung der kapitalistischen Staaten in der DDR eine „Erziehung zum Hass“ erforderlich sei. Wir gingen an einem Abend in das Cabarett „Die Distel“ und erlebten den letzten oder vorletzten öffentlichen Auftritt von Wolf Biermann in der DDR. Wir sprachen mit wichtigen Leuten und – welch Zufall – auch der damalige DDR-Außenminister Bolz schaute scheinbar zufällig bei uns vorbei.[19]
Die Hochschullehrerschaft der PH: Wir hatten in den 60er Jahren in Oldenburg engagierte und fitte Professor*innen, von denen sich viele wenige Jahre später bundesweit einen guten Namen erarbeitet hatten, z.B. Werner Loch (später Uni Erlangen, dannn Uni Kiel), Hans-Jochen Gamm (später Uni Darmstadt), Erwin Schwartz, Gründer des bundesweiten Arbeitskreises Grundschule (später Uni Frankfurt), der Kunstdidaktiker Reinhard Pfennig, der Musikdidaktiker Ulrich Günther, der Werkdidaktiker Hartmut Sellin, der Biologiedidaktiker Ernst Kelle und der schon genannte Heinrich Besuden.
 Rektor der PH war damals Hans-Jochen Gamm (Foto rechts), ein Schüler von Wilhelm Flitner aus Hamburg. Jeden Samstag von 8 bis 10 Uhr hörten wir seine Vorlesung zur Allgemeinen Pädagogik. Danach folgte von 10 bis 12 Uhr Werner Loch mit einer Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik. Gamm war mit seinem Buch „Führung und Verführung“ (1964) der erste westdeutsche Pädagoge, der eine umfassende Dokumentation der NS-Pädagogik vorgelegt hat. Sein Buch „Der Flüsterwitz im Dritten Reich“ (1963) war Monate lang auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.
Rektor der PH war damals Hans-Jochen Gamm (Foto rechts), ein Schüler von Wilhelm Flitner aus Hamburg. Jeden Samstag von 8 bis 10 Uhr hörten wir seine Vorlesung zur Allgemeinen Pädagogik. Danach folgte von 10 bis 12 Uhr Werner Loch mit einer Vorlesung zur Geschichte der Pädagogik. Gamm war mit seinem Buch „Führung und Verführung“ (1964) der erste westdeutsche Pädagoge, der eine umfassende Dokumentation der NS-Pädagogik vorgelegt hat. Sein Buch „Der Flüsterwitz im Dritten Reich“ (1963) war Monate lang auf der SPIEGEL-Bestseller-Liste.
Meine Zimmerwirtin: Ich wohnte in Oldenburg in der Von-Kobbe-Straße 33 bei Frau Hahn zur Untermiete – ein Zimmer ohne Toilette, aber nahe zur PH. Sie hatte ein eher schlichtes Gemüt und verwickelte mich immer wieder in Gespräche, die ich gleich hinterher aufschrieb.[20]
Frau Hohn: Oh, dass der Kennedy tot ist, Herr Meyer. Das ist aber schade. Der war so jung und schön, so stracks geradeaus. Den fand ich viel besser als Hitler. – Kann man das sagen, Herr Meyer?
Hilbert: Nein, kann man nicht!
Einige Mitglieder der ESG waren am Abend vorher bei mir zu Besuch, um das Programm für das nächste Semester zu besprechen. Am nächsten Abend:
Frau Hohn: Herr Meyer, die Untermieter haben sich beschwert. Gestern Abend um Halbzwölf sind noch drei Jungen und drei Mädchen aus dem Haus gekommen. Das geht aber nicht so spät. Nachher komme ich noch ins Gerede. Es haben schon mal welche Nacktbilder gemacht, und dann musste die Wirtin anschließend zur Polizei!
Hilbert: Aber da war doch ein Pastor dabei!
Frau Hohn: Umso schlimmer!
Im Nachhinein beurteile ich die an der PH Oldenburg erfahrene Ausbildung sehr positiv. Wir haben wirklich große Teile des Handwerkszeugs für den Lehrerberuf erworben und auch eine Menge über die Theorie und Geschichte der Pädagogik gelernt. „Aus der Praxis – für die Praxis“ galt bei uns nicht.
3.3 Erstes Lehramtsexamen
Im fünften Semester habe ich mich zur Prüfung gemeldet und bestand am Geburtstag meiner Mutter, dem 7.7. 1964 die „Erste Prüfung für das Lehramt an Volksschulen“.
Merkwürdige Notenfindung: Die Gesamtnote im Examen war „mit Auszeichnung“ – eine Note, bei der drei Zweien und drei Einsen zu einer Gesamt-Eins zusammen gezogen wurden, obwohl die Praktikums-Zwei auch nur aus einem befriedigend und einem gut addiert worden war. Heutzutage hätte das niemals die Gesamtnote „sehr gut“ und schon gar nicht „mit Auszeichnung“ ergeben! Ich war deshalb einigermaßen überrascht über das Ergebnis. Unterschrieben ist mein Zeugnis vom nebenamtlichen Leiter des Staatlichen Prüfungsamtes, dem Mathematikdidaktiker Heinrich Besuden, meinem späteren Kollegen auf der Professur für die Fachdidaktik Mathematik.
Die Examensarbeit über "Das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Schleiermachers Begriff der Erziehung" wurde von Werner Loch betreut. Ich hatte mich angestrengt, weil meine erste schriftliche Note an der PH ein „mangelhaft“ war.[21]
Zweitgutachter war Herwig Blankertz. Letztgenannter war damals für vier Semester der Philosoph unserer PH. Es gingen nur wenige Studierende in seine Veranstaltungen über Descartes, Kant und Rousseau. Ich war einer der wenigen. Das war für mich ein Glücksfall. Denn er hat mir angeboten, bei ihm zu promovieren.[22] Und er hat alle entscheidenden Weichen für meinen wissenschaftlichen Werdegang gestellt.
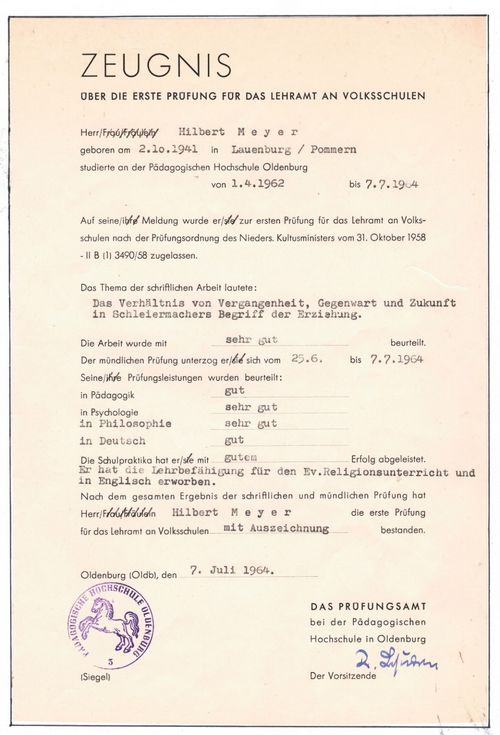
Entlassungsfeier: Der zweite Student, der in meinem Jahrgang ein „sehr gut“ erhielt, war Freerk Huisken, der später Professor an der Uni Bremen wurde, wo er beängstigend lange Anhänger einer maoistischen Splitterpartei blieb und mir in einem seiner Aufsätze vorhielt, den typisch spätkapitalistischen Träumen von der Reformierbarkeit des Systems verfallen zu sein. Sei’s drum – aber er konnte exzellent Cello spielen und hat damit die Entlassungsfeier bereichert.
Damals herrschte großer Lehrermangel. In einer Verlautbarung erklärte das Kultusministerium, dass es sich vorbehalte, von jenen Absolvent*innen, die keine Stelle antreten, einen Teil der Ausbildungskosten einzufordern. Deshalb hatte die GEW bei der Entlassungsfeier einen Stand vor der Aula aufgebaut, auf dem uns versichert wurde, dass wir davor keine Angst zu haben bräuchten.
3.4 Volksschullehrer im Ammerland
Vom 1.8. 1964 bis zum 1.4. 1967 war ich „Lehrer zur Anstellung“ an der Volksschule Ocholt im Landkreis Ammerland, ein kleines Dorf mit vielleicht 1000 Einwohner*innen, 28 km westlich von Oldenburg gelegen. Ein Referendariat gab es damals an Volksschulen noch nicht. Ich musste vom ersten Tag an eine volle Klasse übernehmen und 30 Wochenstunden geben.[23]
Ich war 23 Jahre alt und gab 30 Wochenstunden Unterricht in allen Jahrgangsstufen. Der Einsatzschwerpunkt lag aber in der Grundschule.  Ich wurde sofort Klassenlehrer und begleitete eine zweite Klasse für knapp drei Schuljahre, d.h. dass „meine“ Klasse am Ende meiner aktiven Schulzeit die fünfte Klasse erreicht hatte. Eigentlich war dringend ein Lehrer/eine Lehrerin für die erste Klasse gesucht worden, aber mein Schulleiter, Herr Grummer, sagte mir: „Für einen Anfänger ist eine erste Klasse zu schwierig!“
Ich wurde sofort Klassenlehrer und begleitete eine zweite Klasse für knapp drei Schuljahre, d.h. dass „meine“ Klasse am Ende meiner aktiven Schulzeit die fünfte Klasse erreicht hatte. Eigentlich war dringend ein Lehrer/eine Lehrerin für die erste Klasse gesucht worden, aber mein Schulleiter, Herr Grummer, sagte mir: „Für einen Anfänger ist eine erste Klasse zu schwierig!“
Erster Schultag: Am ersten Schultag nach den Sommerferien kam ich leicht angespannt in meine 2. Klasse, die bei ihrer bisherigen Lehrerin, Irmtraud Berg, schon recht gut Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt hatte. Vor der Tür stand die Schülerin Carola Wöbken. Sie begrüßte mich und sagte: „Ich heiße Carola. Ich helfe dir.“ Was dann auch der Fall war.
Alles war für mich neu. Ich hatte mich im Studium nicht mit Grundschuldidaktik beschäftigt und wusste nur ein klein wenig aus dem Stadtschulpraktikum. In den ersten Wochen meiner Tätigkeit waren die Eltern skeptisch, wohl auch weil sie sich Gedanken machten, was solch ein Anfänger alles nicht kann. Aber nach wenigen Wochen waren die Bedenken bei den meisten Eltern verflogen, weil sie sahen, dass ich sehr fleißig war, streng auf die Hausaufgaben achtete[24] und weil es den Schüler*innen offensichtlich Spaß machte, von mir unterichtet zu werden.
Schulleiter: Der Schulleiter, Herr Grummer, war ein freundlicher älterer Herr, der das Wort „Unterrichtsreform“ noch nie gehört hatte, obwohl es aufgrund der Umwandlung seiner Schule zu einer sogenannten Mittelpunktschule eigentlich sehr viel zu tun gab. In meiner ersten Schulwoche bat er mich zu sich und sagte: „Ich zeige Ihnen mal das Dorf!“ Dann fuhren wir mit dem Fahrrad durch das Dorf und ich bekam allerlei kluge Hinweise: „In der Hecke stehen Tollkirschen! Aufpassen, dass die Schüler da nicht rangehen.“ Oder: „In dem Haus da hinten wohnt ein Flittchen. Lassen Sie sich nicht auf sie ein!“
Mentor: Der zugewiesene oder selbst ernannte Mentor war Walter Spellig. Erneut ein Glücksfall für mich, weil er sich intensiv um mich kümmerte und beriet, z.B. in Disziplinfragen, aber auch mit Ideen für den Sprach- und den Sachunterricht. Herr Spellig war im Zweiten Weltkrieg in Rostrup (am Zwischenahner Meer) Flugzeugpilot gewesen, hatte sich in die Tochter der Schnapsbrennerei Ficken im Dorf Lindern bei Ocholt verliebt und sie geheiratet. So blieb er im Norden. Zwei Jahre nach meiner Ocholt-Zeit wurde er zum ersten Seminarleiter für Volksschullehrer*innen im Ammerland ernannt.
Disziplin halten: Ich hatte gut anderthalb Jahre lang Disziplinprobleme. Die Schülerin Angret Hemmieoltmanns meldete sich nach 14 Tagen,  als es wieder recht unruhig geworden war, und sagte: „Du ich weiß was, Herr Meyer: Immer wenn du redest, sind wir still und wenn wir reden, bist du still.“ Irmtraud Berg, von der ich die Klasse übernommen hatte, hospitierte auf meine Bitte und gab mir einen Hinweis: „Die Unruhe in der Klasse kommt nicht von den Schülern, sie kommt von dir selbst.“ Und Walter Spellig sagte mir Monate später in der großen Pause: „Wenn der Egon wieder Mist macht, dann schicken Sie ihn zu mir in die Klasse. Dann setze ich ihn neben seine große Schwester. Und der ist das dann so was von peinlich, dass sie ihn zuhause richtig zusammenstaucht!“
als es wieder recht unruhig geworden war, und sagte: „Du ich weiß was, Herr Meyer: Immer wenn du redest, sind wir still und wenn wir reden, bist du still.“ Irmtraud Berg, von der ich die Klasse übernommen hatte, hospitierte auf meine Bitte und gab mir einen Hinweis: „Die Unruhe in der Klasse kommt nicht von den Schülern, sie kommt von dir selbst.“ Und Walter Spellig sagte mir Monate später in der großen Pause: „Wenn der Egon wieder Mist macht, dann schicken Sie ihn zu mir in die Klasse. Dann setze ich ihn neben seine große Schwester. Und der ist das dann so was von peinlich, dass sie ihn zuhause richtig zusammenstaucht!“
Eine Experimentierhaltung aufbauen: Das Unterrichten hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich machte oftmals Gruppenunterricht. Ich habe immer wieder kleine Experimente gemacht. Ich habe den damals in Mode gekommenen „programmierten Unterricht“ mit selbst gebastelten Miniprogrammen ausprobiert. Mein Lieblingsfach war der Sachunterricht – nach dem Ende der „Heimatkunde“ ein curricular noch sehr wenig besetztes Feld. Ich konnte entsprechend viel experimentieren. Die schriftliche Hausarbeit zum Zweiten Examen hatte dann das Thema "Das didaktische Problem der Verfrühung im Sachunterricht". Um die Arbeit schreiben zu können, habe ich systematisch allerlei Lehrinhalte ausprobiert, die gemäß Richtlinienvorgaben verboten waren. So war es – ziemlich schwachsinnig – verboten, früher als in der vierten Klasse das Thema Feuerwehr zu behandeln. Also hab ich’s in der dritten gemacht. Rechnen mit x und y durfte damals auf keinen Fall früher als in der fünften Klasse angesetzt werden, also habe ich in der dritten damit begonnen. Heraus kam die Unterscheidung einer legitimen „Vorwegnahme“ in der Ordnung des Lehrplans von einer lerntheoretisch zu begründenden falschen „Verfrühung“.[25]
Handlungsorientiert unterrichten: Im Nachhinein habe ich erkannt, dass ich in Ocholt in bestimmten Bereichen das praktiziert habe, was ich 1980 im Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung als „Handlungsorientierten Unterricht“ bezeichnet habe. Wir hatten dafür an der Schule gute räumliche Voraussetzungen. Ich konnte einen Nebenraum unserer Schule nutzen, um ein großes Modell des Dorfes mit den Kindern aufzubauen. Übrigens: der Nebenraum war ein ehemaliges Heim der Hitler-Jugend, in dem immer noch Hakenkreuze an den Deckenbalken zu erkennen waren. Ich war oft mit meiner Klasse im Dorf unterwegs., um einen Bauernhof, die Große Gärtnerei und Apfelmosterei von Hettenhausen und den Bahnhof zu besichtigen. Wir hatten unsere „Moosstelle“ im Wald gegenüber der Schule, wo hin und wieder Geschichten erzählt und Wochenenden eingeleitet wurden. Einmal habe ich als freiwillige Hausaufgabe über die Herbstferien die Aufgabe gestellt: „Baut aus einem Schuhkarton einen Bonbonautomaten, in den man oben ein Zehnpfennigstück einwirft und wo unten ein Bonbon rausfällt!“ Das war allerdings eine echte Überforderung. Sie gelang nur einem Schüler – und dem auch nur mit Hilfe seines Vaters.
Freie Konferenz: Alle 5 bis 8 Wochen traf sich ein Kreis von bis 12 bis zu 20 Kolleg*innen aller Volksschulen der Gemeinde Westerstede zur Freien Konferenz. Wir schauten uns Unterricht je eines Kollegen/einer Kollegin an und machten eine gründliche Nachbesprechung (in der auch heftige Kritik geübt wurde). Danach gab es dann Kaffee und Kuchen. Der Schulrat hatte bei diesen Treffen nichts zu suchen – wir waren selbstorganisiert.[26]
Gehalt: Das Anfangsgehalt betrug 530 DM – damals viel Geld. Ich hatte noch kein Auto und fuhr am Wochenende die sieben Kilometer mit dem Fahrrad zu meinen Eltern in Westerstede. Die Miete (zunächst beim Dorfpolizisten, dann in der freien Wohnung der Ocholter Kindergärtnerin) betrug 50 und später 75 DM. Hinzu kamen 75 DM monatlich für einen Mittagstisch im Gasthof des Dorfes. Ich hatte jeden Monat mindestens 150 DM übrig und kaufte mir das erste Radio meines Lebens. Ich fuhr zur Documenta nach Kassel und kaufte mir eine Radierung des Tachisten WOLS (Wolfgang Schulz) – und dann war immer noch etwas übrig.
 Sportunterricht: Im Studium hatte ich kein einziges Seminar zum Sportunterricht mitgemacht – und nun musste ich in der zweiten und neunten Klasse Sport unterrichten. Vom Klassenzimmer meiner zweiten Klasse zur wenig benutzten Turnhalle waren es dreißig Meter. Deshalb konnte ich, wenn die Klasse unruhig wurde, schnell rübergehen und zehn Minuten lang Völkerball spielen oder eine Bewegungsübung machen. Das hat fast immer funktioniert – danach waren die Schüler*innen wieder aufnahmefähig. Nach einem Jahr kamen die Schüler*innen halbhoch (Foto links), nach zwei Schuljahren war Dreiviertel in der Lage, die Klettertaue in der Turnhalle bis unter die Decke hochzuklettern. Die Jungs in der neunten Klasse wollten immer nur Fußball spielen – und ich traute mich nicht, sie zu etwas anderen zu zwingen. Ich kannte nicht einmal die Regeln. Also habe ich sie gewähren lassen.
Sportunterricht: Im Studium hatte ich kein einziges Seminar zum Sportunterricht mitgemacht – und nun musste ich in der zweiten und neunten Klasse Sport unterrichten. Vom Klassenzimmer meiner zweiten Klasse zur wenig benutzten Turnhalle waren es dreißig Meter. Deshalb konnte ich, wenn die Klasse unruhig wurde, schnell rübergehen und zehn Minuten lang Völkerball spielen oder eine Bewegungsübung machen. Das hat fast immer funktioniert – danach waren die Schüler*innen wieder aufnahmefähig. Nach einem Jahr kamen die Schüler*innen halbhoch (Foto links), nach zwei Schuljahren war Dreiviertel in der Lage, die Klettertaue in der Turnhalle bis unter die Decke hochzuklettern. Die Jungs in der neunten Klasse wollten immer nur Fußball spielen – und ich traute mich nicht, sie zu etwas anderen zu zwingen. Ich kannte nicht einmal die Regeln. Also habe ich sie gewähren lassen.
„Du, ich weiß was, Herr Meyer!“ Ich habe die Direktheit und Ehrlichkeit der Grundschüler*innen genossen. Und wenn interessante, witzige, traurige Sprüche kamen, habe ich sie sofort in einer Kladde notiert. Drei Kostproben:
- Einmal kam eine Mutter und sagte: „Sie müssen den Rolf mehr prügeln. Mein Mann ist Eisenbahner und oft die Woche über weg. Und ich kann das nicht!“ (Ein einziges Mal bekam Rolf von mir eine Ohrfeige, als ich in dem Moment neben ihm stand, als er ohne Vorwarnung seinem Nachbarn mit der Faust ins Gesicht schlug. Er fand meine Reaktion völlig o.k., aber für mich war es eine pädagogische Niederlage, die mich bis heute beschäftigt.)
- Deutschunterricht: Die Schüler*innen haben den Arbeitsauftrag erhalten, Namenswörter aufzuschreiben, die man weder sehen noch anfassen kann. Diese Aufgabe hatte ich gestellt, weil einige Eltern ihre Kinder mit der falschen Regel „Alles, was man sehen kann, wird groß geschrieben, alles andere klein!“ in Verwirrung brachten: Nach fünf Minuten kommt Angret zu mir ans Pult: „Kann ich das schreiben: Mörder! – Die sieht man ja so selten!“
- Auf einem Unterrichtsgang kommt die Schülerin Elisabeth zu mir, druckst herum und fragt dann: „Herr Meyer, hast du eigentlich eine Frau?“ Ich: „Nein, aber das weißt du doch!?“ Elisabeth: „Ich hab wohl eine für dich: meine Cousine. Die geht noch zur Schule und ist 19 Jahre alt. Die kannst du haben. Meine Mama hat gesagt, ich soll dir das bloß nicht sagen, aber ich tu’s doch!“
3.5 Zweites Lehramtsexamen
Am 26. Januar 1967 machte ich in der 4. Klasse mit 44 Schüler*innen[27] das „Zweite Examen für das Lehramt an Volksschulen“. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag. Ich hatte alle Stundenentwürfe gründlich bearbeitet. Ich hatte schon zwei Tage vorher den grauen Anzug mit Schlips getragen, damit die Schüler*innen, die mich nur mit Nietenhose kannten, nicht allzu überrascht waren.
Die Prüfungskommission bestand aus dem Schulrat des Ammerlands, Herrn Helmerichs, aus meinem Mentor, Herrn Spellig, und aus dem von mir angeforderten, fakultativ zugelassenen Oldenburger Hochschullehrer Hans-Jochen Gamm. Ich musste drei Stunden geben, danach folgte ein Fachgespräch. Die erste Stunde Deutsch, die zweite Mathematik. Die dritte Stunde zum Sachunterricht dauerte zwanzig Minuten länger als geplant, weil die Schüler*innen einfach nicht auf die Idee kamen, was da physikalisch passiert, wenn das Thermometer in kochendes Wasser gesteckt wird und die Säule im Thermometer ansteigt. Hans-Jochen Gamm machte dann die spitze Bemerkung: „Herr Meyer hat uns unplanmäßig zum Sieden gebracht.“ Dennoch gab’s für die Gesamtleistung ein „sehr gut“.
Nächste Seite: Am Tag nach dem Examen (und der feucht-fröhlichen abendlichen Examensfeier, die keine Unterrichtsvorbereitung mehr zuließ) mussten meine Schüler*innen einen Aufsatz über den Prüfungstag schreiben.
- Eine Kostprobe der aufgeweckten Schülerin Elke, eine Stütze der gesamten Unterrichtsarbeit, auf der nächsten Seite!
Verbeamtung: Schon fünf Tage später, am 1.2. 67, wurde ich zum Beamten im Schuldienst des Landes Niedersachsen ernannt und schon zwei Monate später, am 31.3. 67, wieder entlassen, weil ich mein zweites Studium in Berlin beginnen wollte.[28]
Die Schülerin Angret wusste, dass ich nach bestandener Prüfung die Schule verlassen würde, und schrieb in ihrem Aufsatz: „Leider hat Herr Meyer die Prüfung bestanden.“
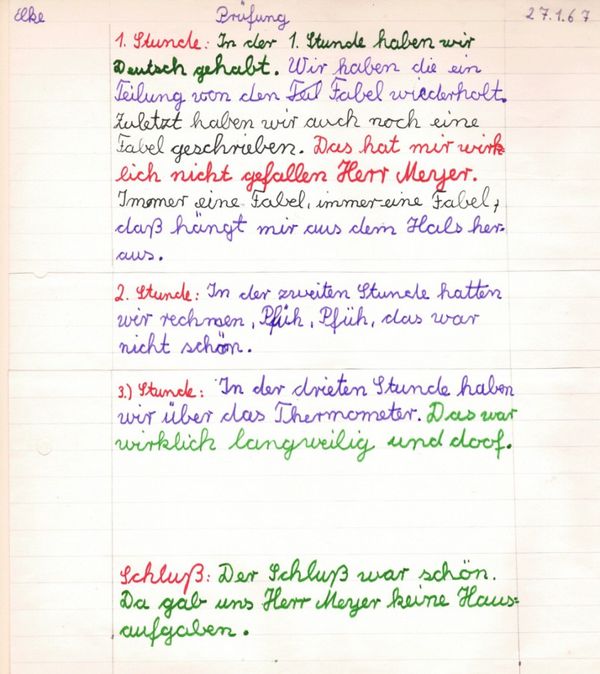
Fazit: Die drei Jahre in Ocholt haben mich sicherlich auch in meiner Hochschullehre deutlich geprägt. Ich habe gelernt, dass Unterricht intensiv vorbereitet werden muss, dass man ohne klare Strukturierung (Merkmal 1 aus meinem Buch „Was ist guter Unterricht?“) viele Chancen für produktives Lernen vergibt, dass das Unterrichten viel persönliche Befriedigung bringen kann und dass anfängliche Probleme überwunden werden können. Deshalb empfehle ich allen Masterabsolvent*innen, der promovieren möchten, um Hochschullehrer*in für Lehramtsstudiengänge zu werden, als erstes das Referendariat zu machen.
4. Promotionsstudium und Arbeit für den Kollegschulversuch
4.1 Just in time – Studium an der Freien Universität Berlin (West)
Vom Sommersemester 1967 bis zum Wintersemester 1968/69 habe ich an der Freien Universität Berlin studiert und mein Promotionsstudium mit dem Hauptfach Erziehungswissenschaft und den Nebenfächern Philosophie und Geschichte begonnen.[29] Zum Promovieren war ich von Herwig Blankertz eingeladen worden. Es war die Zeit, in der diese verzopfte Regel, nicht selbst um eine Betreuung bitten zu dürfen, gerade aufgegeben wurde: „… unter den Talaren Muff von tausend Jahren.“[30]
und den Nebenfächern Philosophie und Geschichte begonnen.[29] Zum Promovieren war ich von Herwig Blankertz eingeladen worden. Es war die Zeit, in der diese verzopfte Regel, nicht selbst um eine Betreuung bitten zu dürfen, gerade aufgegeben wurde: „… unter den Talaren Muff von tausend Jahren.“[30]
- mein erstes Buch: eine Aufsatzsammlung
Herwig (damals noch: Herr Blankertz) gab mir eine Wissenschaftliche Hilfskraftstelle an dem von ihm geleiteten Institut für Wirtschaftspädagogik. Dort lernte ich dann die Assistenten Frank Achtenhagen und Adolf Kell kennen. Mit Frank habe ich vier Jahre später (1971) meine erste Buchpublikation zu einem damals aktuellen Thema gemacht; Der Titel „Curriculumrevision – Möglichkeiten und Grenzen“.
Studentenrevolte: Als ich im Sommersemester 1967 mein Studium in West-Berlin aufnahm, begann auf dem Campus der FU die bald ganz Westdeutschland erfassende Studentenrevolte. Ich kam vom flachen Land und schaute mit großen Augen dem Treiben der Studierenden – von Rudi und Gretchen Dutschke über Gaston Salvatore bis zu Rainer Langhans und Fritz Teufel – zu. Ich genoss es, wichtige Personen life bei Auftritten im Audimax des Henry Ford-Baus in Dahlem zu hören: Theodor Adorno, Herbert Marcuse und andere mehr. Ich erinnere mich, dass wir Studierenden einen Rentner hofierten. Er hieß „der rote Rudi“, kam regelmäßig zu den Teach-ins und hatte irgendwann einmal Lenin die Hand geschüttelt. Hier lernte ich auch handgreiflich, dass zwischen dem eigenen Erleben und der Berichterstattung in den Zeitungen Welten liegen können.
Ich versuchte, Marx und Hegel, Adorno, Herbert Marcuse und Habermas zu lesen und zu verstehen. Das war schwere Kost für mich.
Die Verknüpfung des Studiums mit studentischen Aktionen hat mir Spaß gemacht und meine Eltern in Sorge versetzt. Ich ließ keine Großdemonstration aus. Am 2. Juni 1968 war ich dabei, als eine Demo gegen den Schah von Persien organisiert wurde, bei der dann am Abend Benno Ohnesorg erschossen wurde. Auch ich hatte mit einem Plakat mit persischer Schrift, die ich nicht lesen konnte, vor dem Schöneberger Rathaus (dem damaligen Sitz des Regierenden Bürgermeisters) gestanden und gesehen, wie der persische Geheimdienst SAVAK mit langen Stangen auf einige von uns einprügelte.
Bei allen Veranstaltungen, z.B. den selbstorganisierten Teach-ins im Henry-Ford-Bau der FU und beim großen Anti-Vietnamkriegs-Kongress 1968 in der TU Berlin, hörte ich aufmerksam zu.[31] Wurde in der Innenstadt demonstriert, nahm ich häufig teil, schaute aber erst mal nach, wo die Wasserwerfer der Polizei aufgefahren waren. Dann stellte ich mich auf der gegenüberliegenden Seite auf, so dass mein Rückzugsweg sicher war.
4.2 Westfälische Wilhelms-Universität Münster – Magister Artium
Ab dem Sommersemester 1969 bis zum Wintersemester 1971/72 habe ich an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studiert, weil Herwig Blankertz einen Ruf an diese Hochschule angenommen und Frank Achtenhagen, Adolf Kell und mich aus Berlin mitgenommen hatte. Ich setzte dort das Promotionsstudium fort. Die Fächer blieben gleich: Erziehungswissenschaft, Philosophie und Geschichte. Ich bekam in Münster erneut eine Wissenschaftliche Hilfskraftstelle und konnte gut davon leben.
Auch in Münster war inzwischen die Berliner Studentenrevolte angekommen – aber die Revolte fand nicht – wie in Berlin – auf der Straße statt, sondern auf der Systemebene: Es ging darum, die Instituts- und Fakultätsstrukturen zu demokratisieren. Und daran hatte Herwig einen entscheidenden Anteil.
Magister: Im Februar 1970 legte ich in Münster die Magister-Prüfung ab. Gegenstand der Magisterarbeit war das von Herwig gestellte Thema „Die didaktische Konzeption der Pariser École Polytechnique während der Französischen Revolution“.[32] Magisterstudium und -prüfung wurden von mir im Geschwindtempo absolviert, weil ich die Stelle eines Wissenschaftlichen Assistenten erhalten sollte, für die mein PH-Examen nicht als Voraussetzung akzeptiert wurde. Deshalb hatte Herwig die Idee, den Magister dazwischen zu schieben.[33]
Vom 1.4.1970 bis 30.4.1973 war ich dann Wissenschaftlicher Assistent am Fachbereich Erziehungswissenschaft der Universität Münster.
4.3 Mein Doktorvater Herwig Blankertz
Herwig Blankertz (1927-1983) spielte in meinem wissenschaftlichen Werdegang die entscheidende Rolle. Er hat mich gefordert und gefördert wie niemand sonst. Er ist bis heute mein Vorbild, was die Wahrnehmung der Hochschullehrerrolle angeht, auch wenn ich mich im Blick auf die Theorieproduktion, seinen kritischen Scharfsinn und die bildungspolitische Wirksamkeit in keiner Weise mit ihm messen kann und will. Eine seiner Stärken bestand darin, sehr unterschiedliche Mitarbeiter*innen für gemeinsame Vorhaben zu begeistern, wichtige Arbeiten zu delegieren, dann aber alles zusammen zu fassen und nach außen zu vertreten.[34]

Ende 1944 wurde Blankertz als siebzehnjähriger Soldat eingezogen und verletzt (s.u.). Nach dem Krieg war er zunächst Bauarbeiter, dann Textilarbeiter und Ingenieur. Nach einem Studium an der Hochschule für Gewerbelehrer in Wilhelmshaven machte er dort 1955 seine Staatsprüfung für das Gewerbelehramt (Fachrichtung Textil und Leder). Er qualifizierte sich weiter und machte ein Promotionsstudium bei dem Göttinger Geisteswissenschaftler Erich Weniger (1893-1961), das er 1959 mit einer Arbeit über die Pädagogik des Neukantianismus beendete.[35] Nach einer Station in Hamburg wurde er 1963 Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg, wo ich ihn und seine Frau Gisela kennen lernte. Er wechselte 1964 auf die Professur für Wirtschaftspädagogik an der Freien Universität Berlin und nochmals 1969 auf die Professur für Philosophie und Pädagogik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
Herwig Blankertz war damals die entscheidende Figur an unserem Münsteraner Institut für Erziehungswissenschaft. Und auch in der Schulpolitik des Landes NRW spielte er eine zunehmend wichtige Rolle. 1978 organissierte er als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft den Tübinger Kongress zur „Handlungsrelevanz erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse“ und hielt eine damals viel beachtete Rede, in der er die Ursachen für das Scheitern der Brandt-Scheelschen Bildungsreform von 1972 analysierte.[36]
Nach außen wirkte er stark, aber er war keine Frohnatur, sondern ein zerbrechlicher Mensch. Er hat gelitten, wenn er widersprüchliche Hochentwicklungen in Schule und Hochschule nicht mehr steuern konnte. Er fühlte sich Willy Brandts Forderung „Demokratie wagen“ verpflichtet. Er führte als Münsteraner Dekan die Drittelparität im Fakultätsrat und die Zweierparität in Lehrausschüssen ein und sorgte dafür, dass ein Student Prodekan der Fakultät wurde.
Herwig Blankertz setzte sich für eine wehrhafte Demokratie ein – nicht ohne biografischen Hintergrund: Er hatte als jugendlicher Pimpf im Jahr 1944 in der Hasenheide in Berlin der berühmt-berüchtigten Goebbels-Rede zugehört und mitgegrölt, als Goebbels fragte: „Wollt Ihr den totalen Krieg?“ Als 16Jähriger wurde er, wie mir seine Frau Gisela berichtet hat, Flak-Helfer. Als 17Jähriger wurde er Ende 1944 eingezogen. Zweieinhalb Wochen vor Kriegsende versuchte er in der Nähe von Dessau, eine Hausruine vor den heranrückenden US-amerikanischen Panzern mit einer Panzerfaust zu verteidigen. Das misslang. Stattdessen wurde er von einem der Panzer überfahren und blieb schwer verletzt liegen. In einem amerikanischen Lazarett bei Dessau wurde er notdürftig versorgt und dann entlassen. Er schlug sich zu Fuß zu seiner Mutter ins Rheinland durch. Sein Vater, ein hoher NS-Beamter, ist in den letzten Kriegstagen verschollen.
Die Erfahrung der Nazi-Diktatur hat ihn tief geprägt. Als Lutz van Dick, ein in Hamburg arbeitender niederländischer Sonderschullehrer und Poet, ihn 1981 bat, den Aufruf der von ihm (mit)gegründeten atomaren Abrüstungsinitiative „Pädagogen gegen Rüstungswahn“ zu unterschreiben, schrieb Herwig ihm einen langen Brief, warum er dies nicht tun könne.[37] Mir schickte er eine Kopie und bat mich, meine Unterschrift zurückzuziehen[38], weil ohne Verteidigung Demokratie nicht überleben könne – eine damals unter uns linken Studenten wenig populäre Position, die man heute mit anderen Augen betrachtet. Sein letzter großer Vortrag hatte das Thema „Kants Idee des ewigen Friedens“. 1983 starb Herwig Blankertz viel zu früh an den Folgen eines Verkehrsunfalls.[39]
4.4 Promotion
Am 8. Februar 1972 fand an der Philosophischen Fakultät der Uni Münster meine Disputation im Hauptfach Erziehungswissenschaft und kurz zuvor in den Nebenfächern Philosophie und Geschichte statt. Die Dissertationsschrift hatte den Titel: "Das Deduktionsproblem in der Curriculumforschung".[40] Erstgutachter der Dissertation war Herwig Blankertz, Zweitgutachter der Münsteraner Philosoph Willi Oelmüller. Die Arbeit wurde mit „summa cum laude“ bewertet. Veröffentlicht wurde sie auf Vorschlag von Herwig unter dem generalisierenden Titel "Einführung in die Curriculum-Methodologie" (München 1972).[41]
Die Dissertation prägt meine Haltung zum Theorie-Praxis-Problem der Erziehungswissenschaft bis heute. Ich wollte das Deduktionsproblem unbedingt lösen, erkannte aber nach zwei Jahren Arbeit, dass es nicht lösbar ist.
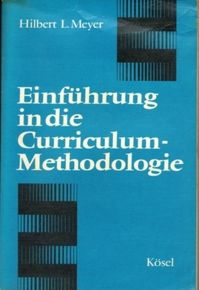
 Seither ist mir bewusst, dass beim Kleinar-beiten von Normen und Prinzipien nicht nur hin und wieder, sondern grundsätzlich größere Spielräume bestehen, als dies viele Autoren normativer Konzepte suggerieren. Jede denkbare „Ableitung“ muss kommunikativ, also mit hermeneutischen Methoden bearbeitet und plausibel gemacht werden. Das geht nicht ohne unterrichtsrelevante Zusatzentscheidungen. Deshalb bin ich bis heute skeptisch gegenüber didaktischen Modellen, die auf Theorieebene kluge Konzepte entwickeln, aber nicht bis in praktische Realisierungen vordringen. Im Schlusskapitel meiner Dissertation steht, dass das ungelöste
Seither ist mir bewusst, dass beim Kleinar-beiten von Normen und Prinzipien nicht nur hin und wieder, sondern grundsätzlich größere Spielräume bestehen, als dies viele Autoren normativer Konzepte suggerieren. Jede denkbare „Ableitung“ muss kommunikativ, also mit hermeneutischen Methoden bearbeitet und plausibel gemacht werden. Das geht nicht ohne unterrichtsrelevante Zusatzentscheidungen. Deshalb bin ich bis heute skeptisch gegenüber didaktischen Modellen, die auf Theorieebene kluge Konzepte entwickeln, aber nicht bis in praktische Realisierungen vordringen. Im Schlusskapitel meiner Dissertation steht, dass das ungelöste
Deduktionsproblem auch für eine „Partisanenstrategie“ genutzt werden könne, die dann darin bestünde, dass die Verfechter einer neuen Praxis ganz bewusst andere (bravere) normative Begründungen abliefern als der innovative Inhalt nahe legt. Das ist von der damaligen CDU-Opposition in NRW aufgegriffen und scharf kritisiert und bis in eine Landtagsdebatte getragen worden.
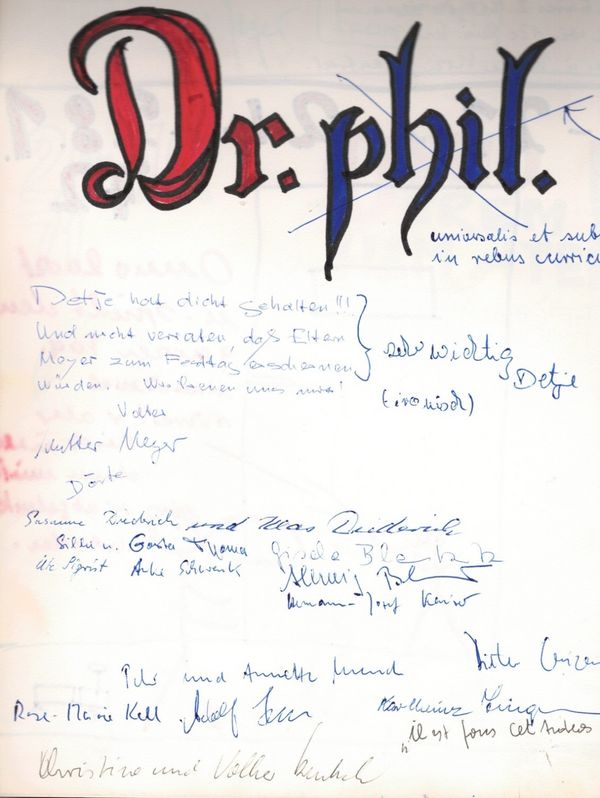
Am Tag der Disputation, also am 8.2. 1972, wurde abends in unserer Wohnung gefeiert. Mitgefeiert haben, wie die abgedruckte Seite aus Meyers Gästebuch zeigt, mein Vater und meine Mutter, meine Schwestern Detje und Dörte, Herwig Blankertz und seine Frau Gisela, Gösta Thoma (später Schulleiter in NRW), Hermann-Josef Kaiser (später Uni Hamburg), Dieter Lenzen (Uni Hamburg), Peter Menck (später Uni Siegen) und Adolf Kell (ebenfalls Uni Siegen), Karl-Heinz Fingerle (später Uni Kassel) und weitere.
4.5 Chaotischer Lehrbetrieb
Ab dem Wintersemester 1969/70 habe ich in Münster am Institut für Erziehungswissenschaft Seminare angeboten, u.a. zu den Themen Curriculumtheorie, Lernzielorientierung und Allgemeine Didaktik. Die Themenwahl war mir weitgehend selbst überlassen. So konnte ich Themen wählen, die ich sowieso gerade für mein Dissertationsprojekt bearbeiten musste.
Das Institut für Erziehungswissenschaft der Uni war, als Herwig Blankertz den Ruf nach Münster annahm, vorsichtig ausgedrückt, verlottert. Es gab 11.000 Lehramtsstudierende mit dem Ziel Gymnasium[42], viel zu wenig Personal, hoffnungslos überfüllte Seminare, kein mit der gültigen Prüfungsordnung abgestimmtes Lehrangebot und eine Prüfungspraxis, in der x-beliebige Themen abgeprüft werden konnten. Einen der ersten Beschlüsse, den Herwig Blankertz nach seiner Wahl zum Dekan durchsetzte, lautete, dass ab sofort nur noch die Noten „bestanden/nicht bestanden“ vergeben wurden, weil angesichts der Überfüllung der Seminare eine differenzierende Notengebung schlicht nicht zu leisten war. Darüber hinaus galt der Grundsatz: „Wer lehrt, prüft!“ Das hatte zur Folge, dass ich als Wissenschaftliche Hilfskraft Mitglied des Landesprüfungsamtes wurde und in jedem Semester 35 bis 40 Prüfungen abnahm.
Lehrausschuss: Zusammen mit dem damaligen Studenten Ulf Mühlhausen (später: Schulpädagoge an der Uni Hannover) war ich der Vorsitzende des paritätisch zwischen Lehrenden und Studierenden besetzten Lehrausschusses. Wir mussten den Mangel verwalten und so gut es ging ein Lehrangebot organisieren, mit dem die 11.000 Studierenden ihre zwei „Scheine“ machen konnten, mit denen sie zur gymnasialen Pädagogikprüfung zugelassen wurden – angesichts der auch damals schon erheblich gewachsenen Ansprüche an den Lehrerberuf eine lachhaft niedrig bemessene Prüfungsvoraussetzung.
4.6 Kollegschulversuch Nordrhein-Westfalen
Vom April 1972 bis zum April 1973 war ich an die von Herwig Blankertz geleitete Wissenschaftliche Begleitung Kollegschule mit Sitz in Münster abgeordnet. Vom 1.5. 1973 bis 31.1. 1975 war ich dann in derselben Funktion als Wissenschaftlicher Angestellter des Nordrhein-westfälischen Kultusministers tätig.[43]
Ziel des Modellversuchs war, die gymnasialen Oberstufen des Landes mit den Berufsbildenden Schulen zu einer völlig neuen Form der Sekundarstufen-II-Schule zu verschmelzen. Meine Arbeitsfelder waren die Betreuung mehrerer Curriculum-Entwicklungsteams, die Betreuung eines Schulstandorts (bei mir: die Stadt Ahaus) und die Entwicklung eines handlungsorientierten Evaluationskonzepts. Wir waren eine aktive junge Mannschaft (Adolf Kell, Günter Kutscha, Dieter Lenzen, Karl-Heinz Fingerle, Barbara Schenk, Andreas Gruschka u.a.) und lernten unter Blankertz’ Anleitung, dass die Implementation eines neuen Schultyps sehr viel schwieriger und anspruchsvoller als das Ausdenken des Konzepts dafür ist.
Hier entstand auch mein erstes Buch mit höherer Auflage, das "Trainingsprogramm zur Lernzielanalyse" (1974), ein Nebenprodukt unserer Betreuung der Curriculum-Kommissionen des Schulversuchs Kollegschule, die allesamt lernzielorientierte Curricula produzieren sollten und eine handfeste Einführung benötigten. – In meinen Augen ist dies eine Jugendsünde (siehe die Erläuterungen in Abschnitt 8.2).

5. Heirat – vier Kinder – Goldene Hochzeit
Das Private ist öffentlich. – So lautete ein Grundsatz der 68er Generation, den ich nicht völlig, aber in einigen Teilaspekten für richtig halte. Deshalb kommt hier in der Mitte dieses autobiografischen Berichts eine Erklärung, dass und warum man nicht Jahrzehnte lang unter Volldampf den Hochschullehrerjob ausfüllen kann, wenn die Familienverhältnisse nicht stimmen.
Christa Konukiewitz, Pastorentochter aus Delmenhorst, und ich hatten uns im April 1962 in der ersten Semesterwoche an der PH Oldenburg getroffen, weil wir zufällig in derselben Praktikumsgruppe gelandet waren (s.o.). Nach einem behutsamen Prozess der Annäherung sind wir dann am 27. Dezember 1969 in Delmenhorst von meinem Schwiegervater Fritz Konukiewitz, Pfarrer an der Stadtkirche, getraut worden. Ich hab’s nie bereut! Christa war und ist der größte Glücksfall meines Lebens. Und sie hat mir geduldig den Rücken frei gehalten und dadurch wesentlich dazu beigetragen, dass ich sehr viel Zeit in meine Berufsarbeit investieren konnte.
an der PH Oldenburg getroffen, weil wir zufällig in derselben Praktikumsgruppe gelandet waren (s.o.). Nach einem behutsamen Prozess der Annäherung sind wir dann am 27. Dezember 1969 in Delmenhorst von meinem Schwiegervater Fritz Konukiewitz, Pfarrer an der Stadtkirche, getraut worden. Ich hab’s nie bereut! Christa war und ist der größte Glücksfall meines Lebens. Und sie hat mir geduldig den Rücken frei gehalten und dadurch wesentlich dazu beigetragen, dass ich sehr viel Zeit in meine Berufsarbeit investieren konnte.
Christa hatte – anders als ich – zum Zeitpunkt unserer Hochzeit ein ordentliches Gehalt und sie besaß eine „Ente“ von Citroen. Im Oktober 1970 sind wir damit – unser frisch geborener erster Sohn Onno auf der Rücksitzbank – nach Nienberge in die Roxeler Straße 13 (heute: Sebastianstraße) gezogen – die erste eigene Wohnung vor den Toren der Stadt Münster!


Fotos: Silvester 1972 auf Langeoog
Vier Kinder: Wir haben vier Kinder, von denen keines Lehrer oder Lehrerin geworden ist. Die Vorfahren meiner Frau kommen aus Ostfriesland. Da haben wir uns gedacht, dass die Kinder angesichts des langweiligen Nachnamens Meyer ruhig etwas seltenere Vornamen bekommen könnten. Deshalb die ostfriesischen Namen Onno, Gesa, Tiedo und Tale. Als der Älteste, Onno, in Oldenburg in die 5. Klasse kam, musste er im Englischunterricht die Familie zeichnen: „This is Meyer fämeli“:
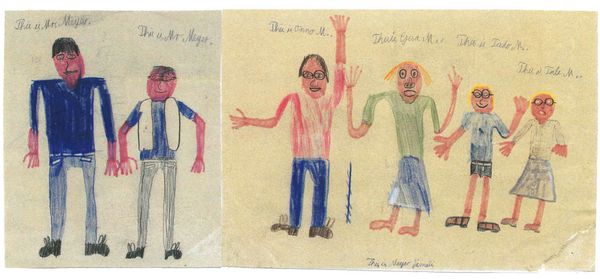
Hauskauf: Im Jahr 1979, als klar war, dass wir in Oldenburg bleiben wollten, haben wir uns im Haarenesch-Viertel ein Zweifamilienhaus gekauft. Wir haben 38 Jahre lang die Darlehen abbezahlt, haben den Kauf aber nie bereut. Inzwischen ist Sohn Tiedo mit Familie in die Oberwohnung eingezogen. Wir sind also ein Mehrgenerationenhaus (samt Enkelkindern, Katze und Schäferhund).

Die Zeichnung (1994) stammt von Tochter Gesa
Nach der Familienphase wollte meine Frau im Jahr 1985 wieder in den Schuldienst eintreten, ab das gelang nicht, weil damals extreme Lehrerarbeitslosigkeit herrschte. 18 Jahre lang arbeitete sie deshalb u.a. als Organistin und Chorleiterin in der Kirchengemeinde Bloherfelde/Oldenburg. Sie engagierte sich in der ökumenischen Friedensbewegung und gründete das Oldenburger Ökumenische Zentrum, deren Vorsitzende sie für lange Jahre war. Sie war 10 Jahre lang für die SPD als Ratsfrau im Oldenburger Stadtparlament. Und sie hat eine Spezialkompetenz: Sie buk und backt sehr leckere Pizzas mit Hügelbeet-Charakter. Deshalb haben wir in 30 Jahren jedes Semester ein ganzes Seminar zum Pizzaessen zu uns nach Hause eingeladen. Bei der Emeritierungsfeier 2009 habe ich nachgerechnet: Es waren insgesamt 2200 Portionen!
Dänemark: Jedes Jahr fuhren wir mit allen Kindern, mit meinen Schwiegereltern, mit der Familie meines Zwillingsbruders, mit meiner Mutter, meiner Schwester Dörte und Waltraud und Friedhelm Zubke, die schon im PH-Studium unsere Freunde geworden waren, in das Dorf Klitmöller in Jütland/Dänemark und machten dort 4 Wochen lang Urlaub – handlungsorientiert, d.h. mit großen Schnitzeljagden, mit Kasperletheater (in einer aus Strandgutholz zusammengehämmerten Kinderbude), mit Pilze-Sammeln, mit viel Baden und langen Strandwanderungen. Nur sich einfach an den Strand zu legen und zu dösen, war nicht unser Ding. Wir kamen immer mit mehreren Familien und hatten oftmals vier oder fünf Ferienhäuser zeitgleich gemietet. Regelmäßig trafen wir dort den Bielefelder Kollegen Theodor Schulze und seine Frau Dorothee. In diesem Jahr (2022) fahren wir das 46. Mal in dieses Dorf, inzwischen mit unserer Tochter, mit unserem Schwiegersohn, der Schwiegertochter und zwei Enkelkindern, mit unserem zweiten Sohn, seiner Partnerin und zwei Enkelkindern, und dann noch mit meiner jüngeren Schwester, meiner Schwägerin und meinem Patenkind. Zusammen gerechnet haben wir dreieinhalb Jahre unseres Lebens in Klitmöller zugebracht, Dänisch können wir leider immer noch nicht.

Meinert Meyer: „Blick in Dänemarks Blüthe“
Bruder Meinert hat immer Ölfarbe und Pinsel mitgenommen und viel gemalt. Einmal hat er als Paraphrase zu Karl Friedrich Schinkels berühmtem Bild „Blick in Griechenlands Blüthe“ (1825) das Bild „Dänemarks Blüthe“ gemalt, das bei uns in Oldenburg an der Wand hängt: vorn Schinkels griechischer Tempel, aber mit dänischem Postkasten, links eine alte Backsteinkirche aus Klitmöllers Nachbardorf Nors (in der Nähe von Klitmöller) und unser Badesee Nors-Sö, ebenfalls nur „um die Ecke“.
Schiffsmodelle bauen: In Klitmöller habe ich ein Hobby entwickelt: Ich habe am Strand Holzreste eingesammelt, die in den 70er und 80er Jahren noch massenhaft vor der der Küste über Bord geworfen wurden, und habe daraus für die Kinder, später dann auch für die Enkelkinder Schiffe gebaut. Das ging natürlich nur, wenn ich meine Werkzeugkiste in den Urlaub mitnahm: 1978 ein Rettungskreuzer für Tochter Gesa, 2020 ein Hafenschlepper für Enkel Lüko – jeweils so groß, dass man gut die Playmobilfiguren zum Spielen benutzen kann. Die Schiffe schwimmen, sie sind ja aus Holz. Aber ihr Schwerpunkt ist so hoch, dass sie zumeist sehr schnell umkippen.


Goldene Hochzeit: Am 27. Dezember 2019 haben wir in der „Krömerei“ in Westerstede mit 75 Verwandten und 15 Freunden unsere Goldene Hochzeit im „engsten Familienkreise“ gefeiert.

Nun werden wir gemeinsam alt, wie das Foto aus dem Jahr 2020 (aufgenommen in unserem Garten in der Kastanienallee in Oldenburg) zeigt und die ersten altersbedingten Zipperlein machen sich bemerkbar.
6. Hochschullehrer an der Carl von Ossietzky Universität
6.1 Eine Professur in Oldenburg – Was willst du mehr!?
Die erste Professorenstelle, auf die ich mich beworben habe, habe ich auch gleich bekommen. [44] Das war die ordentliche[45] Professur für Schulpädagogik (damals H4, dann C 4 und noch später W 3) an der frisch gegründeten Carl von Ossietzky Universität, die damals noch nicht so heißen durfte, weil die FDP im Koalitionsvertrag mit der SPD durchgedrückt hatte, dass der Name des Friedensnobelpreisträgers, der kein Kommunist war, aber für ein breites Bündnis mit allen linken Kräften stand, nicht gewählt werden dürfe. Es war Gerhard Schröder, der gleich nach seinem Regierungsantritt als Ministerpräsident in Niedersachsen im Jahr 1981 ein Gesetz erließ, mit dem sich Universitäten selbst einen Namen geben durften.
Die PH Oldenburg, an der ich studiert hatte, wurde in die neue Uni integriert. So kam es, dass ich auf der früheren Planstelle meines Vaters landete (s.o., Punkt 1.3) und dass ich eine Reihe von Kolleg*innen bekam, bei denen ich zum Teil 11 Jahre zuvor in Seminaren gesessen hatte und von zweien sogar geprüft worden war.[46] Anders als an der Uni Bremen, wo es Jahrzehnte lang heftige Querelen zwischen dem Personal der alten PH und den neu Berufenen der Uni gab, verlief die PH-Integration in Oldenburg erstaunlich reibungslos. Wir Lehrenden organisierten uns nicht in zwei Blöcken „alte PH“ und „neue Uni“, sondern entlang gemeinsamer hochschulpolitischer Fraktionen, die von SPD- und DGB-Vertretern (wozu ich mich zählte) über die undogmatische Linke (insbesondere Anhänger der Frankfurter Schule der Soziologie, mit denen ich in den nächsten Jahren viel und gern zusammengearbeitet habe) bis hin zu den Stamokap-nahen Marxisten. Eine CDU-nahe Hochschullehrerfraktion gab es 1975 an der Uni Oldenburg nicht, angeblich aber zwei Lehrende in den Naturwissenschaften mit CDU-Parteibuch. Zu Beginn einmal wöchentlich, später deutlich seltener trafen wir uns in diesen Fraktionen um 20.00 Uhr zu Lagebesprechungen.
Berufungskommisssion: Da ich von einem Mitglied der Berufungskommission zwanzig Jahre später stiekum-still seinen Leitzordner mit sämtlichen vertraulichen Unterlagen meines Verfahrens erhalten habe, kann ich gut rekonstruieren, wie die Auswahlentscheidung getroffen wurde und was das Kräfteverhältnis in der Kommission war. Die Vorsitzende war die liebenswerte Kollegin Ilse Mayer-Kulenkampff (1916-2008), eine Sozialpädagogin[47], die niemandem etwas zu leide tun wollte und deshalb die heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Hochschullehrer-Fraktionen eher für ein Übel hielt. Weitere Kommissionsmitglieder: der Philosoph Rudolf Lengert, der Psychologe August Schick und der Soziologe Gerd Vonderach sowie der heimliche Strippenzieher in der Kommission, der Inhaber der Professur für Allgemeine Pädagogik Hans-Dietrich Raapke, der wie mein Doktorvater bei Erich Weniger promoviert hatte. Mittelbauvertreter waren Gustav Denzer (der wie ich aus Lauenburg/Pommern stammte) und Friedhelm Zubke (mit dem ich zusammen mein PH-Studium absolviert hatte). Studentische Vertreter*innen waren Gudrun Patel (Mitglied im MSB – Marxistischer Studentenbund Spartakus) und Hans-Joachim Schwebe.
„Vorsingen“: Ich erinnere mich noch genau an meinen Bewerbungsvortrag im Sommersemester 1974. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte als Thema mein damaliges Arbeitsgebiet gewählt (Aufbau eine Integrierten Sekundarstufe II als Fortsetzung der Gesamtschule der Sekundarstufe I) und einen Vorschlag entwickelt, wie man in Oldenburg eine Kollegschule aufbauen könnte. In der sich anschließenden Diskussion fragte Gerd Vonderach, der einen anderen Kandidaten als mich, nämlich Johannes Beck, auf Platz 1 sehen wollte: „Sie haben in Ihrem Vortrag Niklas Luhmann erwähnt. Können Sie nochmal erläutern, was Sie da gemeint haben?“ Meine Antwort: „Sie haben mich an meiner schwächsten Stelle erwischt. Ich bin noch nicht gründlich in die Systemtheorie von Luhmann eingestiegen!“ Ein halbes Jahr später kam Herbert Hasler (früherer Assistent von Erwin Schwartz und damals Hochschuldozent in Oldenburg) zu mir und sagte: „Ich war bei deinem Vortrag dabei. An der Stelle, wo Gerd dich in die Zange genommen hat, habe ich mir gesagt: Das ist genau der richtige für uns, wenn er so offen zugeben kann, dass er etwas nicht weiß.“
ELAB-Bekenntnis: Jede Bewerberin/jeder Bewerber auf Oldenburger Hochschullehrerstellen wurde damals gefragt, ob sie/er bereit sei, sich am Aufbau des projektförmigen Lehramts-Studium der ELAB (s.u.) zu beteiligen. Natürlich beantwortete jede und jeder diese Frage mit „Ja“, weil er sonst keine Chancen auf einen Listenplatz gehabt hätte. Mein früherer Mitstudent und damaliger Rektoratsassistent Meinard Tebben hatte mich darüber schon vorher informiert, so dass ich mich gründlich auf diese Frage vorbereiten konnte.
Mitbewerber*innen: Beworben um die Stelle hatten sich Christine Möller (später Uni Siegen), Johannes Beck (später Uni Bremen), Hans-Dieter Haller (Mitarbeiter von Karl-Heinz Flechsig, Uni Göttingen), Karl Frey (Kiel), Hans Glück (später Uni Köln) und Kurt-Ingo Flessau (später TU Dortmund).
Mein „gefährlichster“ Konkurrent war der Schweizer Kollege Karl Frey (1917-2011). Er war zu dieser Zeit, also 1974, bereits Direktor des Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel (IPN). Mit seiner Habilitation (die mir fehlte) und einer hochdotierten Kieler Stelle war er formal allen anderen Stellenbewerbern weit überlegen. Hätte er auf der Liste gestanden, hätte der damalige SPD-Kultusminister Jost Grolle (vorher Geschichtsdidaktiker an der PH Oldenburg) ihn vermutlich vorziehen müssen, auch dann, wenn Johannes Beck oder ich auf Platz 1 und 2 und er nur auf Platz 3 gestanden hätte. Die Kommission entschied allerdings, ihn gar nicht erst auf die Liste zu setzen, weil sie davon überzeugt war, dass er einen Oldenburger Ruf nur „versilbern“, also nutzen wollte, um in Bleibeverhandlungen sein Kieler Gehalt aufzubessern.[48]
So wurde Johannes Beck (1938-2013), der kurz danach eine Professur an der Uni Bremen erhielt, der zweite für Platz 1 gehandelte Nachwuchswissenschaftler. Er gehörte zur„undigmatischen Linken“ und war damit linker als ich. Die zwei Studierenden stimmten gegen mich, weil ich dem bürgerlichen Lager zu nahe stand. Die Mittelbauern und die Mehrzahl der Hochschullehrer*innen stimmten für mich, weil sie mein Profil für geeignet hielten und dem mündlich und schriftlich eingeholten Urteil von Herwig Blankertz trauten. Er schrieb dann auch eines der zwei Gutachten, dessen Kopie er mir vertraulich zusteckte und mit dem Satz versah: „ … mit einem lachenden und einem weinenden Auge“.
Dreierliste: Hans-Dietrich Raapke favorisierte ursprünglich jemand anderen für Platz 1. Als er sah, dass sich in der Kommission eine Mehrheit für mich herausbildete, schwenkte er um. So gab es eine Dreierliste: Platz 1: Meyer, Platz 2: Beck, Platz 3: Glück.
Ruf erteilt und angenommen: Im Herbst 1974 erhielt ich einen unscheinbaren Brief von Kultusminister Joist Grolle. Er bestand nur aus zwei Sätzen: „Ich biete Ihnen die H4-Professur Schulpädagogik an der Universität Oldenburg an. Nehmen Sie bitte Kontakt mit meinem Referenten Kronshage auf.“ Natürlich habe ich den Ruf angenommen, auch wenn mir der Abschied von der Wissenschaftlichen Begleitung Kollegschule in Münster schwer fiel. Aber zurück in die Heimat Oldenburg zu kommen, hatte für meine Frau und mich unwiderstehlichen Reiz.
Kein Grund, übermütig zu werden: Dass ich gleich die erste Stelle bekommen habe, auf die ich mich beworben hatte, lag wesentlich daran, dass in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts im Zuge der Brandt-Scheelschen Hochschul- und Bildungsreform auf einen Schlag in der BRD gut 30 neue Universitäten und Hochschulen gegründet wurden. Die meisten gingen – wie in Oldenburg – aus PHs hervor. Fast alle dieser neuen Unis hatten Lehrerbildungs-Studiengänge. Deshalb hatten junge pädagogische Nachwuchswissenschaftler*innen, die Anfang der 70er Jahre bewerbungsfähig waren, auch dann, wenn sie nicht habilitiert waren, sehr gute Chancen. Schon 1978 war die Situation deutlich schwieriger geworden und ab 1980 wurden nahezu alle in erziehungswissenschaftlichen Fakultäten frei werdenden Stellen, ersatzlos gestrichen.
6.2 Dienstantritt und Lehrstuhlausstattung
Zum 1. Februar 1975 trat ich meine neue Stelle an der Carl von Ossietzky Universität an und habe sie bis zur Emeritierung zum 1. Oktober 2009 wahrgenommen. Auch danach habe ich auf Basis der Emeritierungsrechte weitergearbeitet.
Zunächst hatte ich überhaupt keine Bleibe. Das große Verfügungsgebäude AVZ am Uhlhornsweg war noch im Bau. Deshalb habe ich die ersten 12 Monate räumliches Asyl im Fachbereich 2 erhalten, und zwar im Zimmer von Meinhard Tebben (Kunstdidaktiker und damals Rektoratsassistent) und Prinz Rudolf zur Lippe (Ästhetikprofessor im Fach Visuelle Kommunikation).
Nach einem Jahr bezog ich dann mein erstes Dienstzimmer im 5. Stock des AVZ (heute A 4) – mit 3 mal 5 m Grundfläche eher bescheidenen Ausmaßes, aber mit einem schönen Ausblick auf die Stadt.  Die Verwaltung hatte versäumt, das Mobiliar für den frisch bezogenen Neubau zu bestellen. Ich habe das Zimmer, wie das Foto zeigt, mit privat beschafften Möbeln ein wenig wohnlicher gemacht. Sehr hilfreich war die als Kreidetafel für Planungsbesprechungen benutzbare Tür. Als ich bei einem Flurgespräch meinem Kolle-gen Hans-Dietrich Raapke gegenüber klagte, keine Einrichtung zu haben, meinte er lakonisch: „So ist das hier. Einen Lehrstuhl kriegen Sie hinterher geschmissen, aber auf einen Stuhl müssen Sie warten!“ Erst im Jahr 1989 bin ich dann im selben Gebäude aus dem fünften in den ersten Stock in ein deutlich größeres Dienstzimmer gezogen (siehe Punkt 6.4).
Die Verwaltung hatte versäumt, das Mobiliar für den frisch bezogenen Neubau zu bestellen. Ich habe das Zimmer, wie das Foto zeigt, mit privat beschafften Möbeln ein wenig wohnlicher gemacht. Sehr hilfreich war die als Kreidetafel für Planungsbesprechungen benutzbare Tür. Als ich bei einem Flurgespräch meinem Kolle-gen Hans-Dietrich Raapke gegenüber klagte, keine Einrichtung zu haben, meinte er lakonisch: „So ist das hier. Einen Lehrstuhl kriegen Sie hinterher geschmissen, aber auf einen Stuhl müssen Sie warten!“ Erst im Jahr 1989 bin ich dann im selben Gebäude aus dem fünften in den ersten Stock in ein deutlich größeres Dienstzimmer gezogen (siehe Punkt 6.4).
Eigene Assistent*innen – Fehlanzeige! Eine eigene Assistentin/einen Assistenten habe ich in meinem ganzen Berufsleben nicht gehabt. Wir wollten damals basisdemokratische Hochschulstrukturen aufbauen, flache Hierarchien fördern und die alten Abhängigkeiten der Assistent*innen von den Profs beseitigen. Das war nicht automatisch ein Nachteil. Es zwang mich, Kooperationspartner*innen auf freiwilliger Basis zu suchen. Und das ist mir zumeist auch gelungen.
Studentische und Wissenschaftliche Hilfskräfte – ein Vergnügen! Assistent*innen gab’s nicht, wohl aber konnte ich regelmäßig studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte einstellen (siehe Punkt 9). Die Hilfskräfte machten eigentlich keine Hilfskraftarbeit im herkömmlichen Sinne, vielmehr wurden sie massiv in meine Lehrveranstaltungen eingebunden. Das zeigt das Foto der Vorlesungssitzung mit der Hilfskraft Manfred Schewe (Punkt 6.4). Die Hilfskraft Eva Pilz, mit der ich bis heute befreundet bin, sagte mir Jahre später: „Du hast uns ganz schön ausgebeutet – aber wir haben viel gelernt.“
Eine ganze Reihe dieser Hilfskräfte hat sich dann auch an Veröffentlichungen beteiligt: z.B. Karsten Friedrichs und Eva Pilz am Buch „Unterrichtsmethoden“, Andreas Feindt an einer Aufsatzsammlung zur Aktionsforschung, Werner Jank, mit dem zusammen ich 1991/92 die Vorlesung „Einführung in die Didaktik“ hielt, als Koautor für das Buch Jank & Meyer „Didaktische Modelle“ (siehe Abschnitt 8).
Überforderung? Ich war, als ich den Ruf erhielt, 34 Jahre alt. Das war auch damals ein noch jugendliches Alter – nur mein späterer Präsident Michael Daxner hatte schon im zarten Alter von 28 Jahren eine Professur an der Uni Osnabrück erhalten. Ich erinnere mich, ein wenig Angst vor der eigenen Courage gehabt und mir vorgenommen zu haben, drei Jahre lang „auf Probe“ die Professur wahrzunehmen, um dann zu entscheiden, ob ich dem Amt auf Dauer gewachsen sei oder nicht. Nach drei Jahren war diese Entscheidung für mich klar.
6.3 Modellversuch zur Einphasigen Lehrerbildung (ELAB)
Vom ersten Semester der Uni-Gründung an (Sommersemester 1974) wurde der bundesweit beachtete Oldenburger Modellversuchs zur Einphasigen Lehrerausbildung (ELAB) durchgeführt.[49] Als ich in Oldenburg ankam, waren die Planungen weitgehend abgeschlossen. Vom Februar 1975 bis zum Sommersemester 1985 habe ich mich dann aber intensiv an der Umsetzung der Planungen beteiligt. Diese ersten zehn Jahre der Beteiligung an integrativer Lehrerbildung haben meine Art und Weise zu lehren, stark geprägt.
Kontaktlehrer*innen: Ein wichtiges Element des Modellversuchs ELAB waren die „Kontaktlehrer“– Lehrer*innen aus der Region, die für zehn Unterrichtsstunden freigestellt wurden, um sich an der praxisnahen Ausbildung der Oldenburger Studierenden zu beteiligen. Es waren immer überdurchschnittlich engagierte Menschen aus dem Einzugsbereich der Universität, deren Beitrag zum Erfolg des Modellversuchs kaum zu überschätzen ist. Viele von ihnen sind später Schulleiter*innen und/oder Dezernent*innen geworden.
Mitwirkende Lehrer*innen: Nach Abbruch des Modellversuchs wurde das Nachfolgemodell der Mitwirkenden Lehrer*innen eingeführt. Sie hatten nur noch eine Freistellung von 2 Stunden. Mit beiden Gruppen habe ich intensiv zusammen gearbeitet. Mit Liane Paradies und Johannes Greving verbindet mit eine bis heute anhaltende Freundschaft. Dorothea Vogt z.B. hat ganz offiziell meine Vorlesung „Einführung in die Schulpädagogik“ mitgestaltet. Daraus sind dann die im ZpB gedruckten Bücher Nr. 15 und 16 geworden (siehe die HOMEPAGE-Datei „Veröffentlichungen: Bücher“). Besonders viele Mitwirkende Lehrer*innen – manchmal bis zu zwölf – haben als Teammitglieder bei dem BLK-Modellversuch zur Teamforschung mitgewirkt (siehe Abschnitt 7.4). Ohne sie hätten wir diese breit angelegte Praxisforschung niemals durchführen können.
Fehlende Prüfungsordnung: Die ersten drei Jahre hatten wir nicht einmal eine Prüfungsordnung für das einphasige Studium. – Das Kultusministerium hatte es schlicht nicht schneller geschafft. Das war aber kein Nachteil, weil wir große Spielräume hatten und im Blick auf die Themenstellungen und Arbeitsformen eigentlich tun und lassen konnten, was wir wollten.
Abbruch: Im Jahr 1976 wurde nach dem Regierungswechsel von der SPD zur CDU in Hannover beschlossen, den Oldenburger Modellversuch abzubrechen, obwohl er kostenneutral war und in dem vom Niedersächsischen Kultusministerium in Auftrag gegebenen Abschlussgutachten von Kurt Ewert, Carl-Ludwig Furck und Werner Ohaus (1981) positiv evaluiert wurde. Der Modellversuch lief dann aber noch eine Reihe von Jahren weiter, weil die immatrikulierten Studierenden einen Rechtsanspruch auf den Abschluss ihres Studiums hatten.
 Fahrrad-Demo: Im Jahr 1976, als von der neuen Landesregierung eine rabiate und existenzbedrohende Kürzung der Ausbaupläne für die Universität Oldenburg beschlossen worden war, haben wir mit der ganzen Uni (1000 Studierende, 100 Professor*innen) eine Fahrrad-Demo organisiert. Wir sind über das flache Land von Dorf zu Dorf und von Region zu Region bis nach Hannover gefahren, haben auf Campingplätzen oder Schützenvereinswiesen gezeltet und haben dann vor dem Landtag demonstriert. Das Medienecho war gewaltig. In den Annalen der Universität ist die Fahrrad-Demo breit dokumentiert. Deshalb nur der dezente Hinweis: Weil ich meinen 6 Jahre alten Sohn Onno auf dem Fahrrad mitgenommen hatte (siehe Foto), bin ich nur bis Wildeshausen mitgefahren.
Fahrrad-Demo: Im Jahr 1976, als von der neuen Landesregierung eine rabiate und existenzbedrohende Kürzung der Ausbaupläne für die Universität Oldenburg beschlossen worden war, haben wir mit der ganzen Uni (1000 Studierende, 100 Professor*innen) eine Fahrrad-Demo organisiert. Wir sind über das flache Land von Dorf zu Dorf und von Region zu Region bis nach Hannover gefahren, haben auf Campingplätzen oder Schützenvereinswiesen gezeltet und haben dann vor dem Landtag demonstriert. Das Medienecho war gewaltig. In den Annalen der Universität ist die Fahrrad-Demo breit dokumentiert. Deshalb nur der dezente Hinweis: Weil ich meinen 6 Jahre alten Sohn Onno auf dem Fahrrad mitgenommen hatte (siehe Foto), bin ich nur bis Wildeshausen mitgefahren.
Fazit: Bis heute ist die Einphasige Lehrer*innenbildung für mich ein zukunftsweisendes, keineswegs utopisches, sondern mit gewissen Modifikationen realisierbares Modell für die Lehrer*innenbildung des 21. Jahrhunderts. Leider ist die 1990 gegebene Chance, bei der Wiedervereinigung von BRD (alt) und DDR die in der DDR praktizierte Einphasigkeit auf ganz Deutschland auszuweiten, nicht genutzt worden.
6.4 Projektstudium
In den ersten Jahren des Modellversuchs stand das Projektstudium im Mittelpunkt des gesamten Lehramtsstudiums. Dafür wurden große Projektgruppen gebildet, die aus bis zu 120 Studierenden, bis zu 15 Lehrenden und 15 Kontaktlehrer*innen bestanden.
SPASC: Mein erstes, über zwei Jahre laufendes Projekt mit 12 Lehrenden und 120 Studierenden hatte den Titel „SPASC – Schülerorientierte Projektarbeit als schulnahe Curriculumentwicklung“. Dort habe ich u.a. den Kollegen Ingo Scheller kennen gelernt. Von seinem Konzept des szenischen Spiels habe ich viel gelernt und mehrere Arbeitsformen abgekupfert, die dann in das Buch Unterrichtsmethoden (1987) aufgenommen worden sind. Im SPASC-Projekt wurde ich schnell der Zuständige für die Unterrichtsvorbereitung und -auswertung. Ein gemeinsam mit Ingo Scheller verfasster Vorläufer für das Buch „Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung“ mit dem Titel „Rezeptbuch für die schriftliche Unterrichtsvorbereitung“ entstand in diesem Projekt.
BASEK (Basiskompetenzen für die Sekundarstufe): Ein zweites, deutlich kleineres Projekt haben Rüdiger Semmerling und ich 1980/81 mit weiteren Lehrenden und knapp 40 Studierenden auf die Beine gestellt. Wir haben Schulstrukturen analysiert, sind aber auch zweimal zu Hochschulen in den Niederlanden gefahren: einmal nach Groningen an die Rijksuniversiteit zu John Peters, dann nach Amsterdam an die Vrije Universiteit zu Jacques Carpay.
September 1980: BASEK-Studierende machen auf der in Oldenburg veranstalteten ATEE-Konferenz (Association for Teacher Education in Europe) eine Informationsveranstaltung, bei der sie über die Kernelemente der ELAB informierten und den Abbruch beklagten:

Unterrichtspraktisches Halbjahr der Einphasigen: Im dritten Studienabschnitt, der in etwa dem Referendariat entsprach, absolvierten die Einphasigen ihr unterrichtspraktisches Halbjahr an einem der Schulstandorte des Modellversuchs. An seinem Ende stand die praktische Examensprüfung. Alle Dozenten waren an der Betreuung in dieser Phase beteiligt.
Prüfungsvorbereitung: Die gründliche allgemein- und fachdidaktische Ausbildung der einphasigen Studierenden war überlebenswichtig im ELAB-Modellversuch, weil die Studierenden in den unterrichtspraktischen Prüfungen oftmals auf feindlich gesonnene Gymnasialdezernenten stießen, die die Einphasige Ausbildung für eine marxistisch inspirierte Fehlkonstruktion hielten und zumeist sehr scharf zensierten. Sie hatten Bedenken, dass der hohe Anteil an erziehungs- und gesellschaftswissenschaftlichen Studieninhalten die gründliche fachwissenschaftliche Ausbildung gefährden könnte. Als unangemessen empfanden sie darüber hinaus, dass sich in Oldenburg große Teile der Professorenschaft mit den Studierenden duzten. Sie befürchteten eine Kumpanei.[50]
Absolventenstudie? Leider gibt es bis heute keine seriöse Absolventenstudie zu den ELAB-Studierenden. Aufgrund vielfältiger Kontakte, die ich bis heute zu diesen ehemaligen Studierenden habe, bin ich mir sicher, dass diejenigen, die trotz hoher Lehrerarbeitslosigkeit in den 80er Jahren eine Planstelle erhalten haben, ihre Aufgaben – anders als von einer ganzen Reihe der Dezernenten befürchtet – sehr gut bewältigt haben. Hunderte von ihnen sind Jahre später Schulleiter*innen geworden, andere waren in der freien Wirtschaft erfolgreich.
6.5 Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit und der Lehrtätigkeit
Ich habe mich in den 47 Jahren Hochschullehre in fünf fachliche Schwerpunkte eingearbeitet und sie in Forschung und Lehre vertreten:
- Allgemeine Didaktik (seit 1975)
- Unterrichtsmethodik (seit 1981)
- Schulpädagogik (seit 1988)
- Aktionsforschung (seit 1994)
- Schul- und Unterrichtsentwicklung (seit 2000).
Diese Schwerpunktsetzungen spiegeln sich auch in meinen Buchveröffentlichungen.
Dolmetscher – kein Empiriker: Ich bin kein empirischer Unterrichtsforscher, sondern ein in der Tradition der Bildungstheorie ausgebildeter Didaktiker. Eigene empirische Untersuchungen gibt es von mir überhaupt nicht, wenn man von der noch zu skizzierenden Teamforschung (Punkt 7.4) absieht. Ein wesentlicher Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit bestand und besteht darin, mich als Dolmetscher wichtiger Forschungsergebnisse zu betätigen und Lehrbücher für Studierende, Referendar*innen und berufserfahrende Lehrer*innen zu verfassen, in denen Standardaufgaben des Lehrberufs und Entwicklungsfragen der Schule beschrieben werden. Ich stehe zur Wichtigkeit der Dolmetscherarbeit. Sie bringt die erziehungswissenschaftliche Theorieentwicklung nur wenig voran, aber sie erleichtert die Rezeption bei denen, auf die es ankommt, nämlich bei den Praktiker*innen in der Schule.
Vorlesungen: Von Beginn an habe ich, wie dies von einem Professor/einer Professorin erwartet wird, Vorlesungen gehalten – und das immer mit großem Vergnügen.[51] Als wir vormittags noch die Zeittaktung 9 – 11 Uhr und 11 – 13 Uhr hatten, habe ich morgens von 8 bis 9 Uhr vorgelesen. Das hat die studentische Teilnahme in nichts behindert. Später wurden es dann zweistündige Veranstaltungen, oftmals mit handlungsorientierten Anteilen – wie auf dem Foto, auf dem Manfred Schewe, damals meine Wissenschaftliche Hilfskraft, heute Universität Cork/Irland, in der Aula der Uni einen Baustein in der Vorlesung über Johann Heinrich Pestalozzi gestaltete:

Vorlesung WiSe 1992/93: „Pestalozzi“ mit Manfred Schewe
Skripte: Für jede Vorlesungssitzung habe ich bis zu meiner Emeritierung ein 10 bis 20 Seiten langes Skript verfasst, im Druckzentrum der Uni drucken lassen, zu Hause mit Hilfe meiner Frau geheftet und dann zu Beginn jeder Sitzung an die Studierenden verteilt. Als 1980 das erste Mal genauer kontrolliert wurde, wer wieviele Druckaufträge verteilte, stand ich einsam an der Spitze der ganzen Universität. Zwei Vorteile dieser Arbeitsweise: Die Studierenden brauchten sich keine teuren Lehrbücher zu kaufen und ich konnte aus der dicken Skriptesammlung, die in jedem Semester entstand, ein Lehrbuch machen, das dann vom Zentrum für pädagogische Berufspraxis gedruckt wurde. So sind der „Leitfaden“, die „Unterrichtsmethoden“ und die „Didaktischen Modelle“ entstanden (siehe Abschnitt 8).
Lehrangebot: Anbei ein paar Auszüge (aus den Vorlesungsverzeichnissen von 1975 bis 2006) zu den von mir angebotenen Lehrveranstaltungen, die damals noch jedes Semester als gedrucktes Buch erschienen. Mein Pflichtdeputat bestand aus 8 Semesterwochenstunden. Oftmals wurden es 10 Stunden, aber niemals mehr als 11!
Sommersemester 1975:
- Vorlesung: Einführung in die Curriculumforschung
- Projektplenum SPASC (= Schülerorientierter Projektunterricht als schulnahe Curriculumentwicklung)
- Projektorientierter Kurs (nur für SPASC-Mitglieder): Vorbereitung von Projektunterricht
- Seminar: Feiertagsdidaktiken und alltägliche Unterrichtsvorbereitung[52]
zusätzlich ab 1977:
- Betreuung einphasiger Studierender „vor Ort“ in ihren Schulen, in denen sie ihr unterrichtspraktisches Halbjahr absolvieren und die Prüfungen machen.
Wintersemester 1989/90:
- Vorlesung: Einführung in die Allgemeine Didaktik
- Seminar: Vorbereitung auf das Allgemeine Schulpraktikum
- Seminar: Betreuung und Auswertung des Allgemeinen Schulpraktikums in Leipzig[53]
- Seminar: Körpersprache im Unterricht
Sommersemester 1994:
- Vorlesung: Unterrichtsmethoden
- Seminar: Vorbereitung auf das Allgemeine Schulpraktikum
- Seminar: Betreuung und Auswertung des Allgemeinen Schulpraktikums
- Kompaktseminar: Zukunftswerkstatt Lehrerbildung
- Promotionscolloquium
Sommersemester 2000:
- Seminar: Vorbereitung auf das Allgemeine Schulpraktikum
- Seminar: Betreuung und Auswertung des Allgemeinen Schulpraktikums
- Seminar: Einführung in die Teamforschung
- Seminar: Bilingualismus und Handlungsorientierung im Fremdsprachenunterricht (gemeinsam mit Heike Rautenhaus, Fachbereich 11)
- Promotionscolloquium
Wintersemester 2003/2004:
- Vorlesung für das Modul 1.01.02 des Master-Studiengangs: Einführung in die Schulpädagogik (gemeinsam mit Hanna Kiper, Wilhelm Topsch und Tutor*innen)
- Seminar: Übungen zur Unterrichtsmethodik
- Seminar zur Teamforschung
- Vorbereitung auf das Allgemeine Schulpraktikum
- Promotionscolloquium
Wintersemester 2005/2006:
- Vorlesung mit Übungen: Merkmale guten Unterrichts (mit Mitwirkenden Lehrer*innen)
- Seminar zur Teamforschung
- Vorbereitung auf das Allgemeine Schulpraktikum
- Seminar: Lehren und Lernen in der Sekundarstufe I
- Seminar: Vorbereitung auf die mündliche Pädagogikprüfung
- Promotionscolloquium
Handlungsorientierte Seminararbeit! Ich habe immer große Befriedigung darin gefunden, gemeinsam mit den Studierenden Seminare vorzubereiten. „Normale“ Referate gab es in meinen Seminaren so gut wie nie. Ich verteilte die Seminarthemen jeweils an ein Team von 3 bis zu 5 Studierenden und vereinbarte mit ihnen eine oder zwei Vorbesprechungstermine. Dann mussten die Studierenden den Ablauf der Seminarsitzung mit mir planen, sie dann selbst leiten, den Theorieinput geben und die regelmäßig stattfindende Kleingruppenarbeit organisieren.

Juni 1993: Kompaktseminar Handlungsorientierter Unterricht
Direkt nach der Seminarsitzung fand eine Feedbackrunde statt. Für alle Teilleistungen zusammengenommen erhielt das Studierendenteam dann einen kollektiv benoteten Leistungsnachweis. Andreas Feindt (heute Uni Münster), mit dem ich bis heute viel zusammenarbeite, sagte mir vor 15 Jahren: „Hilbert: deine Vorlesungen fand ich nicht so spannend! Was hängen geblieben ist, sind die gemeinsamen Planungssitzungen!“
Neues Arbeitszimmer: In meinem 1989 neu bezogenen, deutlich komfortableren Dozentenzimmer im ersten Stock des Gebäudes A 4 gab es für die Planungssitzungen, wie das unten stehende Foto zeigt, einen großen Tisch und links eine alte Kreidetafel, die die Hausmeister für mich organisiert und an die Wand geschraubt haben.[54]

mein Dozentenzimmer 1989 bis 2009
Auf nach Berlin an die Humboldt-Uni? Im Jahr 1991 wurde ich auf Initiative meines Kollegen Dietrich Benner aufgefordert, mich auf die Professur für Schulpädagogik an der Humboldt-Universität Berlin zu bewerben. Gute Chancen wurden mir über den zuständigen Abteilungsleiter des Wissenschaftssenators signalisiert. Ich habe kurz geschwankt, ob ich auf diese interessante Anfrage eingehen sollte, bin dann aber doch in Oldenburg geblieben. In Berlin wäre ich mutmaßlich über kurz oder lang wieder für die schulpraktischen Studien zuständig geworden und hätte dann sehr viel Kraft in die Organisation des nach der Wiedervereinigung im Personalbestand radikal zu kürzenden, in seiner Arbeitsweise neu zu strukturierenden Instituts investieren müssen. Ich sagte mir, dass es angesichts meines Kompetenzprofils klüger wäre, in Oldenburg zu bleiben, zu lehren und Bücher zu schreiben. Ausschlaggebend war dann aber meine Frau Christa, die erklärte: „Du kannst ruhig nach Berlin gehen – aber ich und die Kinder bleiben hier!“ Damit war die Frage entschieden, auch wenn ich bis heute darüber nachdenke, ob es eine etwas egoistische Entscheidung war.
Arbeitspensum: Ich habe bis zur Emeritierung gern und viel gearbeitet. Und auch danach hat sich dieser Zustand nicht grundsätzlich verändert. Ich tue bis heute (2022) einfach so, als ob ich noch nicht pensioniert bin. Aber ich genieße die Freiheit, selbst entscheiden zu können, was ich tue und wo ich eine Absage zu einer der immer noch eintrudelnden Anfragen gebe (Vorträge, Gastprofessuren, Promotionsbetreuungen). „Viel“ hieß bis zur Emeritierung, dass ich die Woche durch bis Sonntagabend arbeitete und montags früh wieder neu begann. Allerdings habe ich ab 1990, als die Kinder aus dem Haus waren, praktisch jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht – 30 Minuten, niemals länger.
Workoholic? Einige meiner Bekannten behaupten, ich sei ein Workoholic. Dem widerspreche ich, weil ich mich nicht süchtig fühle, weil die Arbeit anderen nützt und weil ich meine „Krankheit“ nicht verheimliche. Selbstbestimmtes Arbeiten dient, wie schon Karl Marx analysiert hat, der Selbstverwirklichung. Und Theodor Adorno hat irgendwo einmal angemerkt, Professoren bräuchten keinen Urlaub, weil sie ihren Arbeitsplatz autonom gestalten können.[55] Dem stimme ich der Tendenz nach zu. Die Arbeit kann sehr befriedigend sein. Es gibt auch viele Spielräume im Hochschullehrerberuf, aber wenn man sie missbraucht, führt dies recht bald zur sozialen Isolierung in der Fakultät.
6.6 Praktikumsbetreuung
Von Beginn meiner Lehrtätigkeit an, also ab 1975 bis 2009, habe ich in jedem Semester ein Vorbereitungsseminar für die Praktika angeboten, zunächst für die Praxisphasen der ELAB, dann für das erste Allgemeine Schulpraktikum (ASP) in der alten Lehramtsprüfungsordnung und dann im Bachelor-Studiengang. Dies schloss ein, die Studierenden in den Semesterferien zu betreuen und danach ein gemeinsames Auswertungsseminar zu machen. Zunächst waren dafür 4 Stunden des Lehrdeputats vorgesehen, nach der Umstellung auf den BA/MA-Studienbetrieb gab es nur noch zwei Semesterwochenstunden – in meinen Augen ein Fehler und großes Ärgernis. Man braucht sich dann nicht zu wundern, wenn aus schieren Zeitgründen die Betreuung vor Ort und die Auswertung der Praktika schludrig vorgenommen werden.
- Unterrichtspraktisches Halbjahr in der ELAB: Von 1975 bis 1985 bestand die Betreuung im Rahmen des ELAB-Modellversuchs vor allem in der Begleitung des sogenannten Unterrichtspraktischen Halbjahrs, das mit der integrierten Ersten und Zweiten Examensprüfung abgeschlossen wurde. Dort hatten wir Lehrenden Funktionen, die heutzutage die Fachleiter an den Studienseminaren haben. Wir kamen weit herum, weil die Standorte der Studierenden von Emden und Leer über Oldenburg, Nordenham bis nach Delmenhorst und von Verden bis nach Cuxhaven reichten. Dann fuhr ich morgens los, oftmals um 6 Uhr, um rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn an den Schulen zu sein. Diese vielen Unterrichtsbesuche haben starken Einfluss auf meinen „Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung“ (s.u., Abschnitt 8) gehabt, der damals entstand.
- Allgemeines Schulpraktikum in der zweiphasigen Lehrerbildung und in der BA/MA-Ausbildung: Ab 1973 wurde – parallel zum auslaufenden ELAB-Modellversuch – wieder das „normale“, mit dem staatlichen Ersten Lehramtsexamen abzuschließende Studium eingeführt. Ich war in unserem Fachbereich für die Organisation des darin enthaltenen Allgemeinen Schulpraktikums (ASP) zuständig und habe das auch immer gern getan. Dabei gab es eine chronische Unterversorgung mit Deputatstunden, die erst bei Einführung des Bachelor-Master-Studiums aufhörte, weil ab diesem Termin die Kapazitäten erstmalig an unserer Uni spitz berechnet wurden, so dass noch während des laufenden Semesters bei zu hohen Immatrikulationszahlen an unserem Institut zusätzliches Personal eingestellt wurde, wenn auch auf ausbeuterisch schlecht bezahlen Stellen.[56]
Ein Highlight – Praktikum in Leipzig: In den Sommersemesterferien 1991 haben wir mit tatkräftiger Unterstützung von Edgar Rausch von der PH Leipzig (s.u., Punkt 7.6) das Allgemeine Schulpraktikum nach Leipzig verlegt, um die Arbeitsbedingungen der Lehrer*innen in dieser absoluten Umbruchphase zu studieren und zugleich die ersten Gehversuche im Unterrichten vorzunehmen. Es war eine nachdrückliche Erfahrung für alle. Untergebracht wurden wir in einer leerstehenden Etage eines Studentenwohnheims in Leipzig-Grünau. Und Detlef Spindler vom ZpB (siehe Abschnitt 7.1) übernahm die Reisekosten.
6.7 Dekanat
Aus Pflichtbewusstsein und nicht, weil es mich danach gelüstet hätte, habe ich für das Dekansamt kandidiert, bin dann auch gewählt worden und habe das Amt zunächst zwei Jahre (von 1989 bis 1991) und dann wegen der Erkrankung meines Nachfolgers, Erich Westphal, ein weiteres Semester im Jahr 1993 ausgeübt.
Von jedem neu ernannten Dekan machte die Pressestelle der Universität ein Foto (links) für das UNI-INFO. Die Seele der Fachbereichsgeschäftsstelle war Ingrid Wiese, mit der man bestens zusammenarbeiten konnte



(Foto Mitte). Hinzu kam die ebenso sympathische und sachkompetente Edith Suhrkamp (rechts). Die beiden haben uns Dekane immer wieder auch durch schwierige Fahrwasser hindurchgeleitet.
Kooperation mit der DDR: Mitten in meine Dekanszeit fiel die Wiedervereinigung von DDR und BRD. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie im Herbst des Jahres 1989 plötzlich und unangemeldet die Professorin Regine Pauls von der Mendelssohn-Bartholdy Musikhochschule in Leipzig in der Tür stand und sagte: „Ich bin Regine Pauls. Ich komme aus dem revolutionären Leipzig. Ich möchte mit Euch Kontakt aufnehmen!“ Und das hat sie dann auch getan. Mehr dazu im Abschnitt 7.6.
Demonstrationen gegen den IRAK-Krieg (zweiter Golfkrieg): Auch in Oldenburg hatte es heftige Demonstrationen gegen den Irak-Krieg der USA im Januar 1991 gegeben. Die Oldenburger Studierenden besetzten am 19. Januar den Pferdemarkt und legten für einen halben Tag den gesamten Verkehr lahm. Die Polizei hatte viel zu tun, es blieb aber friedlich. Ich habe dann den damaligen Polizeichef, Polizeidirektor Achim Borne, in die Universität in unseren Fachbereich eingeladen, um auf einer von mir gemeinsam mit dem AStA organisierten Podiumsdiskussion über den Polizeieinsatz und das Demonstrationsrecht zu diskutieren. Darüber wurde ausführlich am 25.1. 1991 in der NORDWEST-Zeitung berichtet.
Hochschul-Ranking – Platz 1 für unseren Fachbereich: Ein Highlight meiner Dekanszeit ergab sich, als Ende 1989 das erste Mal ein bundesweites Ranking der Lehr- und Forschungsqualität (westdeutscher) erziehungswissenschaftlicher Fakultäten durch das Centrum für Hochschulentwicklung (damals Hannover) vorgenommen wurde. Mein Fachbereich fand sich – zur Überraschung vieler anderer Universitäten – auf dem Spitzenplatz, noch vor Bielefeld, Tübingen und FU Berlin. Das Medienecho war groß. Ein Chinese und zwei Japaner schauten vorbei, um unseren Fachbereich zu inspizieren. Wir waren ein wenig stolz darauf, auch wenn im Nachhinein herauskam, dass die Datengrundlage für dieses erste Ranking noch sehr dünn war. Aber bei späteren Rankings zählten wir immer noch zur Spitzengruppe!
6.8 Promotionsbetreuungen
Seit 1975 habe ich in Oldenburg Promotionen betreut sowie Promotions- und Habilitationsgutachten verfasst. Auf dieser HOMEPAGE findet sich eine Auflistung. Anlass für die Herstellung dieser Liste war die Frage der chinesischen Doktorandin Lin Ling: „Wie viele Promotionen hast Du schon betreut?“ – Ich wusste es nicht, habe mich dann aber an die Arbeit gemacht.
Von 1977 bis 2022 habe ich insgesamt 45 Promotionen betreut und als Erstgutachter bewertet. Hinzu kamen 32 Zweitbegutachtungen und 26 Habilitationsgutachten. Das ist eine ganze Menge! Aber Wolfgang Klafki aus Marburg, der für uns alle die Benchmark liefert, hatte doppelt so viele Erstbegutachtungen. Am anderen Ende der Skala bewegt sich Hartmut von Hentig. Er kümmerte sich kaum um seine Doktorand*innen und hat dann auch nur vier oder fünf Menschen zur Promotion geführt. Nach jeder Disputation (bis zu zwei Zeitstunden, mit 5 Professor*innen) wurde ein Gruppenfoto gemacht. Unten das Foto der Disputation von Andreas Feindt (jetzt: Uni Münster).

2006: Abschluss der Disputation von Andreas Feindt[57]
Zurzeit führe ich das Promotionscolloquium gemeinsam mit Barbara Moschner und meinem Lehrstuhl-Nach-Nachfolger Till-Sebastian Idel durch.[58] Es macht unverändert Spaß, auch wenn es einmal ein dramatisches Ereignis gab.[59]
Auf der nächsten Seite ein Scann aus Meyers Gästebuch, Wir haben am 13. Februar 2017 in der Kastanienallee 40 Ye Xupings Promotion gefeiert. Xuping ist, wie viele Chinesinnen, ein wenig abergläubisch. Deshalb war sie wegen des Termins Freitag, den 13ten, in Sorge. Es hat aber bestens geklappt.
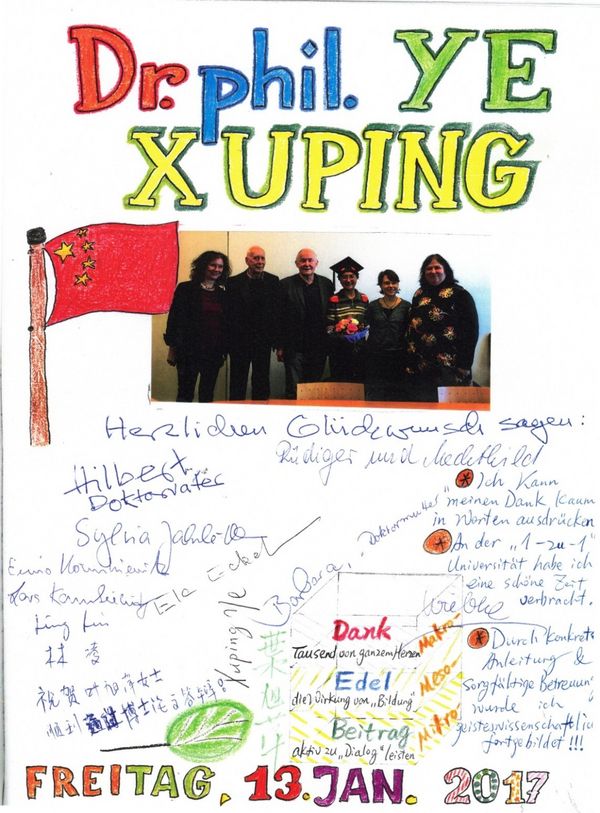
v.l.n.r.: Sylvia Jahnke-Klein (Prüferin der Wahl), Wolfgang Fichten (Prüfer des verwandten Fachs), HM (Erstgutachter),
Ye Xuping, Ulrike Krause (Vorsitzende), Barbara Moschner; Zweitgutachterin
Professuren „meiner“ Doktorand*innen: Eine ganze Reihe der Doktorand*innen (Erst- und Zweitbegutachtungen) hat inzwischen einen Lehrstuhl erhalten oder ist zum apl. Professor/zur Professorin ernannt worden, z.B. Falk Rieß, Ingo Scheller, Irmhild Wragge-Lange, Klaus Klattenhoff, Wolfgang Fichten (alle an der Uni OL), Rainer Bromme[60] an der Uni Münster, Werner Fölling an der Uni Dresden, Christian Wopp in Osnabrück, Ulf Gebken in Essen, Simone Seitz in Bremen, Frank Hellmich in Paderborn. Viele meiner Oldenburger Doktorand*innen haben auch Lehrstühle im Ausland: Haimo Fensterseifer (Uni in Santa Maria, Brasilien), Manfred Schewe (Uni Cork, Irland), Manfred Pfiffner (PH Zürich), Catherine Walter-Laager (Uni Graz: dort ist sie inzwischen Vizerektorin), Ye Xuping (Uni Hefei in der Provinz Anhui, VR China).
6.9 Promotions-Reisekader
Sechzehn Jahre lang kooperierte ich mit Volker Wendt, einem meiner früheren Doktoranden, der das gemeinsam mit Barbara Moschner  verantwortete Promotionscolloquium organisatorisch betreute und auch einige Doktorand*innen gecoacht hat.[61] Er hatte die Idee, einige der Doktorand*innen im Ausland zu besuchen. So kam es, dass wir beide Vortrags- und Fortbildungsreisen (auf eigene Kosten) nach Japan, Bolivien, China und Grönland gemacht haben.
verantwortete Promotionscolloquium organisatorisch betreute und auch einige Doktorand*innen gecoacht hat.[61] Er hatte die Idee, einige der Doktorand*innen im Ausland zu besuchen. So kam es, dass wir beide Vortrags- und Fortbildungsreisen (auf eigene Kosten) nach Japan, Bolivien, China und Grönland gemacht haben.
Japan: Im Jahr 1999 haben wir Nobuyuki Harada in Japan besucht, der Pläne hatte, in Deutschland (Hildesheim oder Oldenburg) zu promovieren. Damals war er Dozent für Erziehungswissenschaft an der Uni Kumamoto. Er wechselte dann an die Uni Gifu und inzwischen ist er Professor an der Municipal University Nagoya. Wir haben uns Unterricht angeschaut und ich habe einen Vortrag gehalten.

Kumamoto (Japan) 1999
Bolivien: Im Februar/März 2001 waren Volker Wendt und ich in Bolivien – zunächst an der Deutschen Schule in Santa Cruz, dann an der Deutschen Schule in La Paz, am Goetheinstitut in La Paz und bei unserer Doktorandin Barbara Heiß, die zum Thema "Integrationspädagogische Lehrerfortbildung in Bolivien“ arbeitete. Mit ihr haben wir in El Alto (oberhalb von La Paz auf 4100 m Höhe) die von der UNESCO unterstützte Elementarschule Mariscal Braun besucht (Foto).
China: Im März/April 2006 waren Volker und ich das erste Mal zu Vorträgen und Fortbildungen nach China eingeladen, und zwar an die East China Normal University in Shanghai (zu Xu Binjan), an das Germanistik-Department der Universität Nanjing (zu Ni Jenfu) und an die erziehungswissenschaftliche Fakultät der Anhui Normal University in Wuhu (Provinz Anhui). In Shanghai haben Volker und ich die in Oldenburg studierende Germanistik-Doktorandin Huang Xueyuan besucht. In Wuhu haben wir Vorträge an der Uni gehalten und das Dissertationsprojekt der bei mir promovierenden Ye Xuping besprochen.
Inzwischen bin ich acht Mal zu Universitäts- und Schulbesuchen in China gewesen. Die Hospitationen an chinesischen Schulen waren für mich immer hoch interessant und irritierend zugleich: Den Chinesen gelingt es, wie ihre Spitzenplätze in den PISA-Studien seit 2009 belegen, mit einem stark lehrerzentrierten Unterricht, aber auch mit hoher Lernbereitschaft, ja Lernbegeisterung in kompetenzorientierten Tests zu hohen kognitiven Lernerfolgen zu kommen, von denen wir in Deutschland weit entfernt sind. Eine schlichte Imitation kommt für mich aber nicht in Frage. Es bleibt die Frage, ob und wenn ja was wir bei uns besser machen könnten als bisher.

Das Bild auf Seite 62 stammt aus dem Jahr 2016. Es zeigt die Referent*innen der 12th Curriculum Conference an der East China Normal University in Shanghai: vordere Reihe zweiter von links: Manfred Pfiffner, dritte Catherine Walter-Laager, vierter HM; dritter von rechts: Andrew Porter, USA).
Mehr zum Thema Reisekader auf meiner HOMEPAGE in der Datei „Schul- und Unterrichtsbesuche auf fünf Kontinenten“!
6.10 Prüfungstätigkeiten
Ich habe mein ganzes Berufsleben lang in erheblichem Umfang geprüft. Das Prüfen begann bereits, als ich Wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni Münster war (siehe Punkt 4.5). Eine „Vier“ zu vergeben, fiel mir schwer, eine „Eins“ vergab ich mit größtem Vergnügen und dachte dann oftmals daran, welch sattes Gefühl meine erste „Eins“ am Ende des PH-Studiums ausgelöst hatte. Ich habe den Umfang der Prüfungsfälle grob kalkuliert:
(1) Acht Semester mündliche Prüfungen an der Uni Münster: circa 30 Prüfungen je Semester = 240 Prüfungen
(2) betreute Examensarbeiten in Münster: insgesamt circa 20
(3) Unterrichtspraktische Prüfungen in der ELAB in 12 Semestern (von 1979 bis 1985): circa 60 Prüfungen
(4) EG-Prüfungen: integrierte erziehungswissenschaftlich-gesellschaftswissenschaftliche mündliche Prüfungen (von 1979 bis 1985): circa 200 Prüfungen
(5) herkömmliche mündliche Pädagogikprüfungen im zweiphasigen Studium von 1982 bis 2009 (27 Semester): circa 25 Fälle je Semester = 675 Prüfungen
(6) Examensarbeiten für die Lehrämter von 1982 bis 2000: circa 5 je Semester = 90 Arbeiten
(7) Master-Arbeiten an der Uni Oldenburg von 1997 bis 2009: circa 5 je Semester = 60 Arbeiten
(8) Master-Arbeiten im Studiengang Schulmanagement an der Uni Kiel von 2007 bis 2017: je 5 je Semester = 55 Arbeiten.
Insgesamt waren es round about 1400 Prüfungsfälle. Eine Folge dieses Prüfungsumfangs war, dass ich ab den 90er Jahren praktisch in jeder Schule, die ich in Nordwestdeutschland zur Praktikumsbetreuung oder Fortbildung betrat, auf mehrere, manchmal auch ein Dutzend Lehrer*innen stieß, die bei mir eine Prüfung gemacht hatten.
6.11 Hochschulbeauftragter für Prüfungsangelegenheiten
Von 1990 bis 2009 war ich mit einer kurzen Unterbrechung Hochschulbeauftragter der Universität für die Außenstelle Oldenburg des Staatlichen Niedersächsischen Landesprüfungsamts.
- Schon vor meiner Ernennung hatte ich intensiv und mit großem Vergnügen mit Hans Krull zusammengearbeitet, vorher Schulrat in Delmenhorst – ein Schulkamerad von Walter Kempowski aus Rostock und ein couragierter Mensch, der insbesondere dann, wenn Gymnasialdezernenten in der Einphasigen Lehrerbildung unfaire Noten gegeben hatten, beherzt eingriff oder schon im Vorfeld sein Recht, die Prüfungskommissionen zusammenzusetzen, extensiv nutzte.[62]
- Nach Hans Krull kam Herr Rikowski – das Verhältnis zu ihm war etwas distanzierter.
- Bis zur Schließung im Jahr 2009 des Staatlichen Prüfungsamtes habe ich dann mit dem ehemaligen Edewechter Oberschulleiter Konrad Barth zusammengearbeitet. Das war wiederum sehr konstruktiv.
Meine Aufgabe bestand darin, „ombudsman“ für die Studierenden zu sein, bei Konflikten zu vermitteln und übergreifende Fragen gemeinsam mit dem Leiter der Außenstelle und mit dem Präsidenten des Prüfungsamtes in Hannover zu bearbeiten.
Jedes Semester machte ich in der immer überfüllten Aula Informationsveranstaltungen für alle Lehramtsstudierenden. Das Thema: „Wie bereite ich mich auf die mündliche Pädagogikprüfung vor?“ – Immer gab es dann auch eine Simulation einer Pädagogikprüfung mit „echten Prüfern“ und einer „echten Kandidatin“; es war in diesem Falle meine Studentin Ilka Parchmann (nicht auf dem Foto), die inzwischen Chemiedidaktikerin am IPN in Kiel ist:

1992: Info-Veranstaltung in der überfüllten Aula mit Simulation einer Prüfung (in der Mitte Herr Rikowski, rechts HM)
Ich durfte an sämtlichen Lehramtsprüfungen der Uni Oldenburg teilnehmen und habe das auch – insbesondere in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften – zu Beginn meiner Tätigkeit wiederholt getan. Es waren z.T. irritierende Erfahrungen, weil lange nicht alle Kolleg*innen sich wirklich auf ihre Prüfungskandidat*innen einstellten.[63] Exzellente Erfahrungen habe ich jedoch in den Fachprüfungen des Mathematikdidaktikers Michael Neubrand gemacht. Er prüfte kompetenzorientiert. Er wollte wissen, ob und wie weit sich ein Studierender schon in die Lage einer lernenden Sek-I-Schülerin/eines Schülers versetzen konnte und formulierte dafür pfiffige Reflexionsaufgaben.
Das Amt war – insbesondere seit Erfindung des Internets und der Möglichkeit, E-Mails zu versenden – eine arbeitsaufwendige Sache. Täglich erhielt ich Anfragen zu allen möglichen Problemen. Hin und wieder sprach ich dann mit Kolleg*innen über deren Prüfungspraxis, was nicht immer mit Begeisterung aufgenommen wurde. Deshalb schrieb ich im Jahr 2009 auf der Eröffnungsseite meiner HOMEPAGE: „Ich freue mich über jede Email, die mich nicht erreicht.“ Das ist nun vorbei. Und ich freue mich über Anfragen, Kommentare, Kritiken oder was auch immer.
7. Kooperationen
Eine Professur für Schulpädagogik bietet vielfältige Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen Uni-Einrichtungen, mit Schulen der Region und mit überregionalen Einrichtungen. Das habe ich von Beginn an mit Vergnügen und persönlichem Gewinn getan.
7.1 Zentrum für Pädagogische Berufspraxis
Besonders wichtig und zufriedenstellend war für mich immer die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für pädagogische Berufspraxis und seinem Leiter, Detlef Spindler.  Er hat eine sehr hohe sozialkommunikative Kompetenz und hat es immer wieder verstanden, höchst unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen zu produktiver Arbeit zusammen zu bringen.
Er hat eine sehr hohe sozialkommunikative Kompetenz und hat es immer wieder verstanden, höchst unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen zu produktiver Arbeit zusammen zu bringen.
Ein weiteres Mitglied des ZpB war der Geografiedidaktiker Wolfgang Schranke, der in jedem Herbst die PÄDAGOGISCHE WOCHE (PW) der Universität organisierte, die ein breites schulpädagogisches Fortbildungs-angebot brachte und jeweils von mehreren tausend Lehrpersonen besucht wurde. Ich war wiederholt mit Vorträgen und Workshops dabei.
der Universität organisierte, die ein breites schulpädagogisches Fortbildungs-angebot brachte und jeweils von mehreren tausend Lehrpersonen besucht wurde. Ich war wiederholt mit Vorträgen und Workshops dabei.
Ebenfalls am ZpB arbeitete Hansjürgen Otto, den ich schon locker aus meinem Berliner FU-Studium kannte. Er war ein verlässlicher Partner der Studierenden und beriet sie bei Konflikten an ihren Praktikumssschulen.
Das nächste Foto auf der Seite zeigt die Lehrerin Sabine Nolte (aktuell: Vorsitzende des Bezirkspersonalrats Osnabrück) auf dem Podium der PW-Veranstaltung mit Schüler*innen: „Schule 88 – voll ätzend?“

Pädagogische Woche 1998: „Schule voll ätzend?“ (links: Sabine Nolte)
7.2 Arbeitsstelle Schulreform
Von 1992 bis 2006 hatte ich die Wissenschaftliche Leitung der Arbeitsstelle Schulreform (AS) am Zentrum für pädagogische Berufspraxis der Universität Oldenburg inne – eine Einrichtung des Kultusministeriums, mit der die Schulentwicklung der Region unterstützt und Modelle zur Evaluation erprobt werden sollten. Dafür wurden vom damaligten SPD-Kultusminister Rolf Wernstedt Deputatsstunden an das ZpB abgeordnet – zunächst im Umfang von vier Lehrerstellen, später von zwei. Es gab einen Beirat, zunächst geleitet von dem Osnabrücker Dezernenten Otto Menzel, später von RSD Ernst Wille (Oldenburg) und RSD Klaus Kapell (Wildeshausen). Wir veranstalteten in regelmäßigen Abständen zusammen mit dem Beirat Klausurtagungen, auf denen nicht nur die Arbeitsplanung für das nächste Jahr vorbereitet, sondern auch ein aktuelles Thema der Unterrichtsentwicklung gesprochen wurde.
Schortens: Zu den Aktivitäten der AS zählten u.a. die Einrichtung von Lernwerkstätten, die Beteiligung an schulinterner Lehrerfortbildung (SchiLF) und die Schortenser Schulleiter-Tagungen mit oftmals mehr als 350 Teilnehmer*innen, für die wir bundesweit und auch international bekannte Fachleute einluden: Heinz Rosenbusch und Stephan Huber, Annemarie von der Groeben und Susanne Thurn von der Laborschule, Jürgen Baumert, Klaus-Jürgen Tillman, Hans-Günter Rolff, Peter Posch aus Klagenfurt und Michael Schratz aus Innsbruck, Pertti Kansanen aus Helsinki und Mats Ekholm aus Schweden, der Neurowissenschaftler Gerhard Roth aus Bremen. Kommentar von Ha-Gü Rolff, Dortmund: „Wir beneiden Euch für das, was Ihr in SCHORTENS aufgebaut habt!“
Ich habe die Zusammenarbeit mit Ina Ulrich, Christel Wopp, Wilm Renneberg, Alida Baumann, Franz Wester und vielen weiteren abgeordneten Lehrpersonen genossen. Dabei habe ich die AS-Leitungsaufgabe nie so verstanden, dass ich die Richtschnur vorgab. Wichtiger war, dass die abgeordneten Lehrer*innen ihre Stärken einbringen und weiter entfalten konnten:

Klausurtagung mit der AS an der Historisch-Ökologischen Bildungsstätte in Papenburg
7.3 Forschungswerkstatt „Lehrer*innenbildung“
1994 machte ich ein Kompaktseminar mit dem Titel „Zukunftswerkstatt Schule“. Das Ergebnis war, dass die Studierenden (u.a. Carola Junghans, Andreas Feindt, Bettina Kappelhoff und Anne Eckermann) die Einrichtung einer Universitätsschule[64] und einer Forschungswerkstatt Lehrerbildung forderten. Wolfgang Fichten, Alexandra Obolenski und ich als Lehrende verbündeten uns mit dieser Initiative und gründeten die Forschungswerkstatt Schule und Lehrer*innenbildung – ein joint venture zwischen dem Fachbereich 1 und dem Didaktischen Zentrum (ehemals ZpB) der Universität.
Wolfgang Fichten, Alexandra Obolenski und ich als Lehrende verbündeten uns mit dieser Initiative und gründeten die Forschungswerkstatt Schule und Lehrer*innenbildung – ein joint venture zwischen dem Fachbereich 1 und dem Didaktischen Zentrum (ehemals ZpB) der Universität.
Die unermüdliche Seele und der Leiter der Forschungswerkstatt war Wolfgang Fichten (hier bei einer Klausurtagung des Nordverbunds Schulbegleitforschung). Die Hauptaufgabe der Forschungswerkstatt bestand darin, die „Basisstation“ für die zeitgleich gestarteten Versuche zur Etablierung unseres Modells der Teamforschung herzustellen.
Nordverbund Schulbegleitforschung: Von der Forschungswerkstatt aus haben wir auch den Nordverbund organisiert, den es bis heute unter dem Namen Nordverbund Praxisforschung gibt.
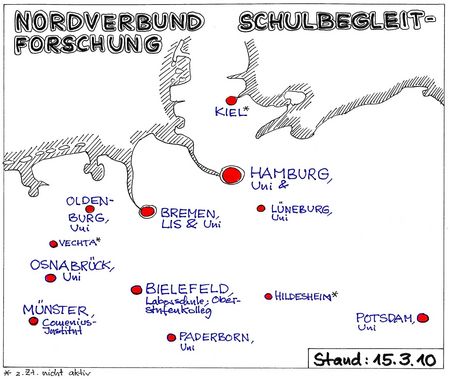
Darin haben sich mehrere norddeutsche Universitäten und Lehrerbildungseinrichtungen zusammengetan. Die erste Initiative dazu kam von Ingrid Kemnade aus Bremen.
7.4 Oldenburger Teamforschung und BLK-Modellversuch
Als Oldenburger Teamforschung bezeichnen wir eine Weiterentwicklung des von Herbert Altrichter und Peter Posch für den deutschsprachigen Raum entwickelten Modells der selbst organisierten Aktionsforschung (collaborative action research). Herbert war wiederholt in Oldenburg und hat uns geduldig gezeigt, wie man’s macht.

1994: Herbert erläutert die Grundsätze der Aktionsforschung
Während die Österreicher einzelne Lehrerinnen und Lehrer ihre eigene Unterrichtspraxis erforschen ließen, haben wir in Oldenburg von Beginn an Teams gebildet, in denen 3 bis 7 Studierende gemeinsam mit je einer Mitwirkenden Lehrerin/einem Lehrer (s.o.) ein wichtiges Unterrichtsproblem oder eine Schulentwicklungsaufgabe untersuchten.
Wir hatten ein Prozessmodell entwickelt, an das sich die einzelnen Teams – jeweils aus einer Lehrperson und vier, fünf oder sechs Studierenden bestehend, halten konnten.

Wir starteten jeweils mit einem Kompakttag (am Samstag und Sonntagvormittag), in dem in vier für unsere Ziele geeignete Forschungsmethoden zur Datenerhebung eingeführt wurde: Fragebogen, Interview, Strukturlegetechnik und Gruppendiskussion. Dann folgte eine lange Phase der Arbeit in den einzelnen Teams – vor Ort an der Schule der Lehrperson und in der Universität. Wir endeten mit einem Präsentationstag, auf die die 6 bis 12 Teams einer Kohorte ihre Forschungsergebnisse präsentieren konnten und dann alle ein Zertifikat als „Teamforscher*in“ erhielten.

Zertifizierung des Teams der KGS Wittmund
BLK-Modellversuch: Von 2000 bis 2005 erhielten wir – auch aufgrund des Engagements von Alexandra Obolenski und ihren guten Kontakten zu Grünen-Politikern im Kultusministerium Niedersachsen – eine insgesamt 250.000 Euro umfassende Förderung als Modellversuch der Bund-Länder-Kommission (BLK) der Kultusministerkonferenz.

Foto Seite: Mitglieder unseres BLK-Moderationsteams: Ute Warm (Supervisorin), Carola Junghans (abgeordnete Lehrerin),
Ulf Gebken (auf einer Koordinationsstelle) und seine Nachfolgerinnen Ela Eckert und Uta Wagener.
Wir erprobten unser Teamforschungskonzept im Studienbetrieb (was weiterhin sehr gut ging), aber auch – gemeinsam mit den Studienseminaren in Aurich und in Leer – in der Zweiten Phase der Lehrerbildung (was angesichts der eng getakteten Ausbildungsschritte der Studienseminare mühsam war).
Die Arbeit hat uns allen viel Spaß gemacht. Leider ist aus der Monografie zur Oldenburger Teamforschung, die Wolfgang Fichten und ich nach 2005 schreiben wollten (und wofür wir schon die Veröffentlichungszusage des Cornelsen-Verlags hatten) nichts geworden. Es gibt aber viele Aufsätze und auch drei Aufsatzsammlungen, in denen das Modell beschrieben wird.[65]
7.5 DDR-Kontakte und Wiedervereinigung
Ich hatte keine Verwandten in der DDR und deshalb die DDR bis 1989 nur bei der Berlin-Reise zur FDJ der Humboldt-Uni (s.o. Punkt 3.2) kennen gelernt. Seit 1984 hatte ich dann aber intensive Kontakte zu Lothar Klingberg (1926-1999). Ich hatte ihm mein Buch „Leitfaden zur Unterrichtsvortbereitung“ geschickt. Im ersten Antwortbrief schrieb er, dass er angenehm überrascht sei, dass ich in meinem Buch auf die bei Westdeutschen übliche Häme gegen DDR-Pädagogen verzichtet hätte.
Lothar Klingberg: Er wurde nach traumatischen Erfahrungen als 17jähriger Soldat. [66] direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs „Neulehrer“ (ohne bzw. ohne abgeschlossene Ausbildung) an der Volksschule in Otterwisch in der Nähe von Leipzig..[67] Er hat dann nochmals an der Universität Leipzig u.a. bei dem Philosophen Ernst Bloch studiert, ist dort promoviert und danach mit einer stark durch Herbart beeinflussten Arbeit über „Pädagogische Führung und Selbsttätigkeit in der sozialistischen Schule“ (1962) habilitiert worden..[68] Er wechselte an die Pädagogische Hochschule „Karl Liebknecht“ in Potsdam und wurde zum führenden und weltweit bekannten Allgemeindidaktiker der DDR.[69]
Im Jahr 1986 war Lothar auf Einladung von Otto Lange (Fakultät 1) und mir das erste Mal in Oldenburg, um an der Universität einen Vortrag zu halten. Ein Satz aus seinem Vortrag hat sich mir eingeprägt: „Schüler haben Verantwortung für das Erfolgserlebnis ihrer Lehrer!“
 Im Jahr 1989 waren meine Frau und ich das erste Mal bei Lothar und seiner Frau Renate zu Besuch. Sie wohnten damals mit ihren zwei Söhnen im Schlosspark Sanssouci, und zwar in der ehemaligen Fasanerie, in der zwei Dienstwohnungen für die im Neuen Palais des Schlossparks untergebrachte Pädagogische Hochschule eingerichtet worden waren. Vorher hatte in der Wohnung der Dirigent und Komponist Wilhelm Furtwängler gewohnt. Im Schlafzimmer unter dem Dach, in dem ich untergebracht wurde, hingen noch die Aluminium-Streifen, mit denen sich Furtwängler gegen böse Erdstrahlen schützen wollte.
Im Jahr 1989 waren meine Frau und ich das erste Mal bei Lothar und seiner Frau Renate zu Besuch. Sie wohnten damals mit ihren zwei Söhnen im Schlosspark Sanssouci, und zwar in der ehemaligen Fasanerie, in der zwei Dienstwohnungen für die im Neuen Palais des Schlossparks untergebrachte Pädagogische Hochschule eingerichtet worden waren. Vorher hatte in der Wohnung der Dirigent und Komponist Wilhelm Furtwängler gewohnt. Im Schlafzimmer unter dem Dach, in dem ich untergebracht wurde, hingen noch die Aluminium-Streifen, mit denen sich Furtwängler gegen böse Erdstrahlen schützen wollte.
Spaziergang im Schlosspark Sanssouci mit Hund Tonka;
im Hintergrund die Fasanerie.
Im Jahr 1990 habe ich versucht, meine Fakultät und den Senat der Carl von Ossietzky Universität davon zu überzeugen, Lothar Klingberg – um einen kleinen Beitrag zur inhaltlichen Gestaltung der Wiedervereinigung zu leisten – die Ehrendoktorwürde unserer Fakultät zu verleihen. Das ist daran gescheitert, dass die im Senat erforderliche Dreiviertelmehrheit – auch aufgrund einer sehr unprofessionellen Informationspolitik des damaligen Kanzlers – nicht zustande kam.
Im Jahr 1990 hatten Dorothea Vogt (damals KGS Wittmund) und ich eine Fortbildung für die Dozent*innen der IG-Metall-Bildungsstätten in Berlin organisiert. Wir haben die Gelegenheit genutzt, mit der ganzen Metaller-Gruppe Lothar im Schlosspark in seiner Wohnung zu besuchen:

1991: links: Dorothea Vogt, in der Mitte Lothar Klingberg, rechts HM
Leipzig: Weitere Kontakte hatte ich – von Lothar vermittelt – zu Edgar Rausch (1928-2016) in Leipzig.  1986 hatte er seinem Studienfreund aus Leipziger Zeiten empfohlen, mich nach Leipzig zu einem Vortrag an die Pädagogische Hochschule Clara Zetkin einzuladen. Das dauerte dann aber noch drei Jahre, weil ihn die Stasi – vermittelt über den Direktor für Internationale Angelegenheiten seiner Hochschule – mehrfach zwang, die schon ausgesprochene Einladung wieder zurückzunehmen.
1986 hatte er seinem Studienfreund aus Leipziger Zeiten empfohlen, mich nach Leipzig zu einem Vortrag an die Pädagogische Hochschule Clara Zetkin einzuladen. Das dauerte dann aber noch drei Jahre, weil ihn die Stasi – vermittelt über den Direktor für Internationale Angelegenheiten seiner Hochschule – mehrfach zwang, die schon ausgesprochene Einladung wieder zurückzunehmen.
- links: Edgar Rausch, Schulpädagoge aus Leipzig (1989)
Im Februar 1989 durfte ich dann endlich einreisen und wurde so zum ersten westdeutschen Gastredner an der Clara Zetkin-Hochschule (in den schönen, der Bauhausarchitektur folgenden Gebäuden in der Karl-Heine-Straße).

Mein Visum: direkt aus
Margot Honeckers
Volksbildungsministerium
Das von Edgar Rausch vorgeschlagene Vortragsthema lautete: „Unterrichtsmethodik“. Da konnte ich mich dann gut auf die Vorarbeiten von Lothar Klingberg beziehen. Irritierend fand ich ein dreiviertel Jahr später, dass ich im Februar 89 noch an keiner Stelle gespürt hatte, wie nah das Ende der DDR war und welch erheblichen Anteil daran die mutigen Leipziger*innen haben würden. Hinterher haben mir Renate Klingberg und Elisabeth Fuhrmann berichtet, dass sie das nahe Ende schon ein, zwei Jahre vorher am Sozialverhalten der einfachen Leute erahnt hatten. Diese hatten immer weniger Respekt vor der Staatsgewalt.
Pädagogische Akademie der Wissenschaften – Elisabeth Fuhrmann: 1987 hatte ich auf Anregung von  Lothar Klingberg Kontakt zu Elisabeth Fuhrmann von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (APW) in Berlin aufgenommen.[70] Sie leitete dort ein in der Heinrich-Heine-Schule, direkt an der Berliner Mauer etabliertes Institut.
Lothar Klingberg Kontakt zu Elisabeth Fuhrmann von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (APW) in Berlin aufgenommen.[70] Sie leitete dort ein in der Heinrich-Heine-Schule, direkt an der Berliner Mauer etabliertes Institut.  Sie war in ihrer Karriere ausge-bremst worden, weil sie sich weigerte, aus der katholischen Kirche aus- und in die SED einzutreten.
Sie war in ihrer Karriere ausge-bremst worden, weil sie sich weigerte, aus der katholischen Kirche aus- und in die SED einzutreten.
Otto Lange und ich luden sie 1987 nach Oldenburg ein. Auch hier funkte die Stasi dazwischen und wies Elisabeths Chef, Professor König von der APW an, dieser habe dafür zu sorgen, dass Elisabeth die Einladung mit Vorwänden ablehnte (siehe die Anweisung rechts).[71]
DGfE-Tagung: Im Juni 1990 organisierte Elisabeth Fuhrmann die erste gesamtdeutsche Tagung für die Didaktik-Kommission der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE). Wir tagten in der Heinrich Heine-Oberschule, wo wir auch im Unterricht hospitieren konnten. Es war für alle Beteiligten die nachdrückliche Erfahrung eines Schulsystems im rabiaten Wandel.[72]
Wiedervereinigung: Am Tag der Wiedervereinigung, dem 3.10.1990, lief gerade die PÄDAGOGISCHE WOCHE an der Uni Oldenburg. Ich hatte vermittelt, dass Elisabeth Fuhrmann die Eröffnungsrede hielt. Elisabeth Fuhrmann hielt in der Aula eine beeindruckende Rede über die Perspektiven des Neuanfangs. Wir hatten aber auch viele weitere DDR-Kolleg*innen als Referenten eingeladen.
Am Abend vorher haben meine Frau und ich alle DDR-Kolleg*innen (Elisabeth Fuhrmann, Regine Pauls, Johanna Faust, Ralf Hickethier, Uwe Wyschkon und Edgar Rausch aus Leipzig, Esther Migge aus Saßnitz und andere mehr) zu uns nach Hause geladen, um meinen Geburtstag (2.10.) zu feiern. Wir haben am Abend gemeinsam aus Streichhölzern, Wunderkerzen, Wachs und Sprühfontänen eine „Silvester-Rakete“ (s.o., Abschnitt 1.2) gebaut und abends um 11 Uhr angezündet. Links auf der Rakete prangte die Flagge des Warschauer Pakts, rechts die der Nato. Beide verbrannten. Aber um 23.45 Uhr verabschiedete sich plötzlich drei Viertel unserer Gäste. Die Wehmut war wohl doch zu stark, als dass sie mit lautem Hurra und einem Glas Sekt das Ende der DDR mit uns hätten feiern wollen.
Uwe Wyschkon und Edgar Rausch aus Leipzig, Esther Migge aus Saßnitz und andere mehr) zu uns nach Hause geladen, um meinen Geburtstag (2.10.) zu feiern. Wir haben am Abend gemeinsam aus Streichhölzern, Wunderkerzen, Wachs und Sprühfontänen eine „Silvester-Rakete“ (s.o., Abschnitt 1.2) gebaut und abends um 11 Uhr angezündet. Links auf der Rakete prangte die Flagge des Warschauer Pakts, rechts die der Nato. Beide verbrannten. Aber um 23.45 Uhr verabschiedete sich plötzlich drei Viertel unserer Gäste. Die Wehmut war wohl doch zu stark, als dass sie mit lautem Hurra und einem Glas Sekt das Ende der DDR mit uns hätten feiern wollen.
Lehrstuhlvertretung: Im Wintersemester 1996/97 hat Elisabeth Fuhrmann dann in Oldenburg die Lehrstuhlvertretung während meines Forschungssemesters übernommen. (I n dieser Zeit habe icxh das Buch „Schulpädagogik“ geschrieben.)
Ein Fazit: In den ersten Jahren der Wiedervereinigung waren die Kontakte in die neuen Bundesländer eng und herzlich. Ich war mehrfach in Leipzig und Dresden, in Potsdam und Stralsund. Die Kontakte lockerten sich, wesentlich auch auf Grund der Tatsache, dass zwei meiner engeren Kontaktinstitionen „abgewickelt“ und alles Personal entlassen worden waren: die APW in Berlin und die PH in Leipzig. Dafür kamen neue Kooperationspartner hinzu, die mich wiederholt zu Lehrerfortbildungen eingeladen haben:
- die Hauptschule Parey in Sachsen-Anhalt, mehrfach eingeladen von Anita und Klaus Krüger
- das Landesinstitut ThILLM in Thüringen, eingeladen von meiner ehemaligen Kieler Masterstudentin Marion Tröster
- das Landesinstitut LISA in Halle, im Rahmen der Schulleiterqualifizierung Sachsen-Anhalt
- der Verbund Evangelischer Schulen in Sachsen, wo eine meiner Studentischen Hilfskräfte, Uwe Schmidt, inzwischen Schulleiter geworden war
- das Kreuzgymnasium in Dresden, eingeladen von seiner Direktorin Gabriele Füllkrug
- das Eichsfeld Gymnasium, eingeladen von Marina Parlitz.
Im Land Brandenburg, in dem vieles anders lief als in den übrigen neuen Bundesländern, wurde die PH „Karl Liebknecht“ nicht abgewickelt, sondern in die neu gegründete Universität Potsdam integriert. So ergab sich die Möglichkeit, mit der Grundschulpädagogin Ursula Drews aus Potsdam engere Kontakte zu pflegen.
Auch mit Witlof Vollstädt (ehemals Universität Karl-Marx-Stadt) hatte ich in der Jury für den Förderpreis der Cornelsen-Stiftung „Lehren und Lernen“ mehr als zehn Jahre lang eng und produktiv zusammengearbeitet (s.u., Punkt 7.10).
7.6 Graduiertenkolleg „Didaktische Rekonstruktion“
Von 2001 bis 2006 war ich Mitglied des Oldenburger Graduiertenkollegs „Didaktische Rekonstruktion“ – eine hoch interessante Initiative  des Oldenburger Kollegen und Biologie-didaktikers Ulrich Kattmann. Zusammen mit Ulrich Kattman, Michael Neubrandt, Dietmar von Reeken, Astrid Kaiser u.a. machten wir in zwei Kohorten ein promotionsspezifisches Lehrangebot. Die wesentlich von Barbara Moschner organisierten, international aufgestellten Abschluss-symposien waren Spitze. So konnte ich z.B. Richard Ryan kennen lernen, den viele aus seiner zusammen mit Edward Deci verfassten Selbst-bestimmungstheorie der Motivation kennen. Auf die Initiative von Michael Neubrand und mir war beim ersten Symposium auch Xu Binjan von der East China Normal University in Shanghai dabei.
des Oldenburger Kollegen und Biologie-didaktikers Ulrich Kattmann. Zusammen mit Ulrich Kattman, Michael Neubrandt, Dietmar von Reeken, Astrid Kaiser u.a. machten wir in zwei Kohorten ein promotionsspezifisches Lehrangebot. Die wesentlich von Barbara Moschner organisierten, international aufgestellten Abschluss-symposien waren Spitze. So konnte ich z.B. Richard Ryan kennen lernen, den viele aus seiner zusammen mit Edward Deci verfassten Selbst-bestimmungstheorie der Motivation kennen. Auf die Initiative von Michael Neubrand und mir war beim ersten Symposium auch Xu Binjan von der East China Normal University in Shanghai dabei.
Ich war begeistert von dieser Form der Promotionsförderung. So etwas hätte ich als eigener Doktorand 30 Jahre früher auch gern gehabt! Die interdisziplinäre Zusammenarbeit der vielen verschiedenen Fach- und AllgemeindidaktikerInnen ist in meinen Augen vorbildlich.  Auch wir Lehrende lernten viel voneinander.
Auch wir Lehrende lernten viel voneinander.
7.7 Dozent*innenschulung für die IG Metall
Von 1986 bis 2016 war ich – mit kurzen Unterbrechungen – jedes Jahr bei der IG Metall tätig, um eine einwöchige oder drei Tage dauernde Fortbildungsveranstaltung für die Dozent*innen der fünf IG-Metall-Bildungsstätten – meistens in Sprockhövel, manchmal auch in Berlin-Pichelsee, Bad Lohr oder Bad Beverungen – zu machen.
Das kam so: 1986 hatte der Vorstand der IG-Metall unter seinem damaligen Vorsitzenden Franz Steinkühler beschlossen, die gesamte Bildungsarbeit der IG-Metall zu reformieren.[73] Man wollte von dem starren Kurssystem (Arbeit I, Arbeit II, Kapital 1, Kapital 2) wegkommen und stärker adressatenorientiert arbeiten. Deshalb wurde der Referent von Steinkühler ausgeschickt, neue Fortbildungsdozenten zu gewinnen.  Er fragte u.a. bei Ingo Scheller (ebenfalls Oldenburg) und bei mir nach. Ingo hatte dann andere Prioritäten, aber ich habe sofort zugesagt und über die Jahre eine stabile Kooperation aufgebaut.
Er fragte u.a. bei Ingo Scheller (ebenfalls Oldenburg) und bei mir nach. Ingo hatte dann andere Prioritäten, aber ich habe sofort zugesagt und über die Jahre eine stabile Kooperation aufgebaut.
Die Kolleg*innen der Bildungsstätten arbeiteten hoch professionell. Die Seminare waren für mich jedes Mal eine Herausforderung. Ich nutzte sie auch, um neue Fortbildungsthemen und -methoden zu erproben. Ein Produkt der Zusammenarbeit ist das gemeinsam mit den Gewerkschaftern Martin Allesbach und Lothar Wentzel[74] im Jahr 2009 veröffentlichte Buch „Politische Erwachsenenbildung“ (Veröffentlichungen „Bücher“ Nr. 37).
7.8 Masterstudiengang Schulmanagement an der Uni Kiel
Ab dem Sommersemester 2007 war ich auswärtiges Mitglied des Kollegiums des Masterstudiengangs Schulmanagement an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, die diesen Studiengang in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung Schleswig-Holstein (IQSH) entwickelt hat. Strippenzieher war der damalige Direktor des IQSH, Thomas Riecke-Baulecke (seit 2020 Präsident des Zentrums für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg), der mich so lange bearbeitet hat, bis ich eine Zusage gegeben hatte.
Es handelt sich um einen akkreditierten Masterstudiengang, der mit einer schriftlichen Masterarbeit abgeschlossen wird. Von den Teilnehmer*innen wird eine mehrjährige vorherige Berufstätigkeit im Schulbereich erwartet. Viele der Studierenden hatten vor, sich für eine Schulleitungsaufgabe zu qualifizieren, andere waren bereits Schulleiter*innen. Eine ganze Reihe der Studierenden arbeitete an deutschen Auslandsschulen. Ebenso viele kamen aus dem Ausland. So habe ich z.B. über den Kieler Studenten Ernst Eitzen die inzwischen intensiven Kontakte zu den deutschsprachigen Mennoniten im Gran Chaco in Paraguay aufgebaut (siehe „Schul- und Unterrichtsbesuche weltweit“, auf dieser HOMEPAGE).
 MODUL V: Ich war gemeinsam mit dem Chemiedidaktiker Reinhard Demuth und der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin des IPN, Claudia Fischer, für das MODUL V „Unterricht verbessern und beurteilen“ zuständig. Jedes Semester gab es eine zweitätige Präsenzveranstaltung und mehrere Online-Seminare. Ein Teil der Aufgaben bestand darin, ein Modulhandbuch gleichen Titels zu schreiben. Es ist in zwei Bänden im Oldenbourg Verlag München erschienen (siehe Veröffentlichungsliste Nr. 38 und 39 auf dieser HOMEPAGE). In jedem Semester habe ich fünf bis sieben Masterarbeiten betreut und 25 bis 40 Klausuren gestellt und gemeinsam mit Claudia Fischer bewertet. Die Arbeit war sehr vielfältig und lehrreich. Zwei Absolvent*innen haben im Anschluss an ihr Kieler Studium bei mir in Oldenburg bzw. an der Uni Osnabrück promoviert: Christian Geldermann, inzwischen Schulinspektor für die Bistümer Münster und Aachen; und Christina Peters, Seminarleiterin für Berufsbildende Schulen in Schleswig-Holstein.
MODUL V: Ich war gemeinsam mit dem Chemiedidaktiker Reinhard Demuth und der Wissenschaftlichen Mitarbeiterin des IPN, Claudia Fischer, für das MODUL V „Unterricht verbessern und beurteilen“ zuständig. Jedes Semester gab es eine zweitätige Präsenzveranstaltung und mehrere Online-Seminare. Ein Teil der Aufgaben bestand darin, ein Modulhandbuch gleichen Titels zu schreiben. Es ist in zwei Bänden im Oldenbourg Verlag München erschienen (siehe Veröffentlichungsliste Nr. 38 und 39 auf dieser HOMEPAGE). In jedem Semester habe ich fünf bis sieben Masterarbeiten betreut und 25 bis 40 Klausuren gestellt und gemeinsam mit Claudia Fischer bewertet. Die Arbeit war sehr vielfältig und lehrreich. Zwei Absolvent*innen haben im Anschluss an ihr Kieler Studium bei mir in Oldenburg bzw. an der Uni Osnabrück promoviert: Christian Geldermann, inzwischen Schulinspektor für die Bistümer Münster und Aachen; und Christina Peters, Seminarleiterin für Berufsbildende Schulen in Schleswig-Holstein.
Im Jahr 2017 bin ich aus der aktiven Lehre in Kiel ausgeschieden. Meine Prüfungsberechtigung bleibt aber bestehen und wird auch hin und wieder genutzt.
7.9 LABORSCHUL-Beirat
Die Arbeit eines Hochschullehrers bringt diese und jene Beiratstätigkeit mit sich (siehe die Auflistung im Anhang der Datei „Beruflicher und wissenschaftlicher Werdegang“). Besonders wichtig, aber auch arbeitsintensiv war für mich die von 1992 bis 2017 wahrgenommene Mitgliedschaft im Beirat der LABORSCHULE Bielefeld.
Unsere Aufgabe: Nachdem Klaus-Jürgen Tillmann die Wissenschaftliche Leitung der Laborschule von Will Lütgert übernommen hatte, wurde das von Hartmut von Hentig entwickelte Lehrerforscher-Modell der Laborschule verändert. Es gab keine pauschale Freistellung der Lehrer*innen für Forschungsaufgaben mehr,  sondern nur noch zeitlich befristete Freistellungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FEP). Dafür mussten Projektanträge geschrieben werden. Die wichtigste Aufgabe des Beirats war, diese Anträge mit den Antragstellern zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Diese Aufgabe wurde auf den jährlichen zweieinhalbtägigen Beiratssitzungen erfüllt.
sondern nur noch zeitlich befristete Freistellungen für Forschungs- und Entwicklungsprojekte (FEP). Dafür mussten Projektanträge geschrieben werden. Die wichtigste Aufgabe des Beirats war, diese Anträge mit den Antragstellern zu diskutieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. Diese Aufgabe wurde auf den jährlichen zweieinhalbtägigen Beiratssitzungen erfüllt.
Im Jahr 2017 wurde ich dann in einer kleinen Feierstunde von den Schüler*innen und Kolleg*innen der Laborschule aus dem Beirat entlassen.
7.10 CORNELSEN-Stiftung Lehren und Lernen
20 Jahre lang war ich im Beirat der CORNELSEN-Stiftung „Lehren und Lernen“ tätig. Das auf dem Balkon des Cornelsen-Verlagshauses in Berlin aufgenommene Foto zeigt uns mit der Vorsitzenden des Beirats Ruth Cornelsen.
Unsere Aufgabe bestand darin, Finanzanträge an die Cornelsen-Stiftung zu beurteilen und Empfehlungen auszusprechen. Das Management des Stiftungsgeldes hatte Franz Cornelsen dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft übertragen. Frau Cornelsen als Vorsitzende ließ uns freie Hand und freute sich, wenn wir Pro und Contra einzelner Anträge argumentativ abklopften.

Die Mitglieder des Beirats 2002: HM, Helmut Schwarz, Ruth Cornelsen, Elmar Tenorth und der Vertreter des Stifterverbands
Cornelsen Förderpreis: Aus der Beiratsfunktion heraus wurde ich dann der Sprecher der Jury für den Cornelsen-Förderpreis. Um die mit 6000, 4000 und 2000 Euro dotierten drei Preise konnten sich einzelne Lehrpersonen oder Lehrerteams mit interessanten Schulprojekten bewerben. Die einzige durch den Stiftungszweck bestimmte Voraussetzung für die Bewerbung bestand darin, dass man sich im Projekt um eine wissenschaftliche Begleitung bemühen musste.
Die Jury-Arbeit war, wie schon bei der Laborschule, sehr lehrreich, weil man hier das „didaktische Gras wachsen hören“ konnte. Viele Entwicklungen, die später in die Regelschulen einsickerten, wurden von den Preisträger*innen schon früh durchdacht und erprobt.
Jährlich oder zweijährlich wurden dann die von uns aus den vielen Bewerbungen ausgewählten Preisträger*innen auf die DIDACTA in Stuttgart, Köln oder Hannover eingeladen. Auf der Bühne des Schul-Forums mussten sie ihr prämiertes Projekt vorstellen. Danach hielt ein Mitglied der Jury eine Laudatio. Hinzu kam für die jeweils drei Preisträger*innen ein Geldpreis aus dem Stiftungsvermögen. Stolz wie Oskar fuhren die Gewinner dann wieder nach Hause und sorgten in der Regel dafür, dass es einen Bericht in den lokalen Medien gab.
8. Veröffentlichungen
8.1 Liaison mit dem Cornelsen-Verlag
Es ist ein Recht von Hochschullehrer*innen, die wissenschaftliche Arbeit in der Hochschule mit dem Publizieren von Forschungsergebnissen zu verbinden. Dieses Recht habe ich weidlich ausgenutzt. Rein quantitativ ist meine Veröffentlichungsliste aber deutlich kürzer als die mehrerer meiner Oldenburger Kolleg*innen. Ich habe mich auf Lehr- und Studienbücher konzentriert, die jeweils einen breiten Adressatenkreis hatten und haben. Ein vollständiges und bis zum Jahr 2022 aktualisiertes Schriftenverzeichnis findet sich auf dieser HOMEPAGE. Die Gesamtauflage der insbesondere vom CORNELSEN Verlag Berlin veröffentlichten Monografien beträgt heute (im Jahr 2022) knapp 1.4 Millionen Exemplare. Das ist angesichts der Gesamtzahl von aktuell 880.000 Lehrpersonen in der Bundesrepublik eine ganze Menge, die hin und wieder Erstaunen auslöst.[75] Die hohen Zahlen sind auch dem Leiter des Cornelsen-Scriptor-Verlags Berlin, Horst Linder, zu verdanken, der sich unermüdlich für die Verbreitung meiner Bücher eingesetzt hat.
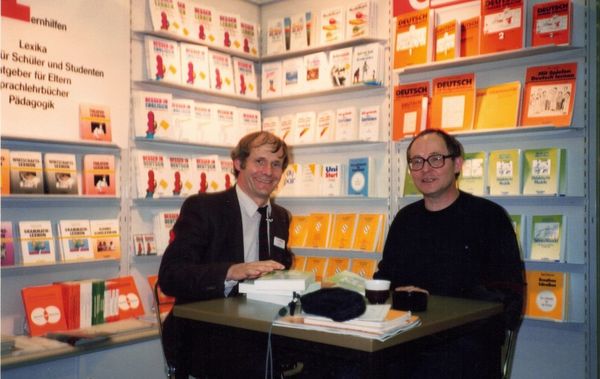
Horst Linder auf Frankfurter Buchmesse 1991 bei der Vorstellung des neu erschienenen Buchs Jank & Meyer „Didaktische Modelle“
Fast alle meine Bücher sind aus konkreten Lehr-Lernzusammenhängen entstanden. Das erklärt zum Teil, warum die Leser*innen hin und wieder die hohe Verständlichkeit der Bücher loben. Ein ehemaliger Student, der jetzt Leiter des Eichen Gymnasiums in Scheeßel (Niedersachsen) ist, lud mich zu einem Vortrag ein und sagte: „Hilbert, ich war zwar öfters ganz anderer Meinung als Du – aber dich konnte man wenigstens verstehen!“ Ganz ähnlich argumentierte bei seinen Vortragseinladungen 2016 und 2022 an das Regionale Berufsbildungszentrum Wirtschaft (in Kiel) der geschäftsführende Direktor und frühere Oldenburger Student Gerhard Müller.
Natürlich gab und gibt es auch einige Kritik, manchmal an dem oftmals lockeren und manchmal flapsigen Tonfall und die manchmal ironischen Bilder (z.B. durch den Kollegen Klaus Prange), aber auch an der für unzureichend gehaltenen theoretischen Absicherung meiner Unterrichtskonzepte. Wolfgang Klafki, mit dem ich im Beirat der LABORSCHULE Bielefeld zusammenarbeiten konnte, sagte mir am Rande einer Sitzung, dass er meine Bücher wiederholt gegen Attacken von Kolleg*innen verteidigt habe.
Als Franz Cornelsen, der Gründer des Verlags, im November 1987 eine Honorarprofessur der Stadt Berlin erhielt, lud er viele seiner Autor*innen zu der Verleihung ins Schöneberger Rathaus. Dort gab es weihevolle Ansprachen über die in der Tat beeindruckende unternehmerische Tätigkeit des Geehrten, bis dann Michael Klett, Inhaber des Klett-Verlags und Hauptkonkurrent des von Cornelsen, und dennoch ein Freund vom Franz, eine launige Ansprache und erklärte, dass er auch solch einen Titel habe, dass man damit eigentlich nichts anfangen könne, dass er aber hilfreich sei, wenn man irgendwo ein Hotelzimmer bestellen will. Nach der Verleihung gab es im Hochhaus neben der Berliner Gedächtniskirche ein Festessen – und da wurden alle geladenen Gäste fotografiert:

November 1987: HM, Herr Thiele (Chef des Hirschgraben Verlags), Franz und Ruth Cornelsen
8.2 Longseller
Bestseller sind schön – aber Longseller, die längere Zeit im Buchhandel erhältlich sind und dann auch hohe Gesamtauflagen erzielen, sind für die Verlage und auch für die praktische Hochschularbeit und die Ausbildung in der Zweiten Phase wichtiger. Einige Longseller aus meiner Feder und deren Entstehungsgeschichte skizziere ich in diesem Abschnitt. Ob und wenn ja welchen Einfluss solche Bücher auf die Lehrerbildung nehmen, ist noch nicht empirisch erfasst. Eine solche Studie würde mich sehr interessieren. Ich selbst kann und will eine solche Fleißarbeit aber nicht mehr unternehmen.
(1) „Trainingsprogramm zur Lernzielanalyse (1974): Es ist eine Jugendsünde aus der Zeit meiner Mitarbeit am Nordrhein-Westfälischen Modellversuch zur Kollegschule, die es immerhin bis zur 14. Auflage geschafft hat (s.o., Punkt 4.6). Das Buch kam zustande, weil damals die Kultusministerkonferenz (KMK) vorgegeben hatte, dass alle neuen Curricula lernzielorientiert zu gestalten seien. Deshalb war die Frage, wie Lernziele angemessen definiert und dann auch „operationalisiert“[76] werden können, damals eine für die Praktiker*innen in den Lehrplankommissionen und für die Ausbilder*innen in der Zweiten Phase wichtige Frage. Von Jugendsünde spreche ich, weil das Thema und Ziel dieses Buches eine systematische Blickverkürzung auf die Zielfrage vornimmt, auch wenn im Buch hier und dort auf dieses Defizit hingewiesen wird, z.B. mit der These, dass man „Emanzipation nicht operationalisieren kann“.
(2) „Leitfaden zur Unterrichtsvorbereitung“ (1980): Ab 1978 hatte ich jedes zweite Semester eine Vorlesung „Einführung in die Unterrichtsvorbereitung“ gehalten und für jede Sitzung ein Skript erstellt (s.o.). Daraus ist dann die universitätsintern vom damaligen Zentrum für pädagogische Berufspraxis veröffentliche Vorfassung des Leitfadens geworden (Bild links). Sie war von Kollegen (nicht von mir!) an vier Verlage weitergespielt worden: an den Klett-Verlag, an Westermann, an Urban & Schwarzenberg und an Scriptor Athenäum (damals ein selbstständiger Verlag in Königstein/Ts.). Alle vier Verlage wollten das Manuskript drucken. Ich habe dann den Redakteuren einen gemeinsamen Brief geschrieben und erklärt, dass ich jenem Verlag die Rechte geben werde, der den niedrigsten Ladenendpreis bietet.[77] Scriptor machte mit deutlichem Abstand das Rennen.[78]
„Einführung in die Unterrichtsvorbereitung“ gehalten und für jede Sitzung ein Skript erstellt (s.o.). Daraus ist dann die universitätsintern vom damaligen Zentrum für pädagogische Berufspraxis veröffentliche Vorfassung des Leitfadens geworden (Bild links). Sie war von Kollegen (nicht von mir!) an vier Verlage weitergespielt worden: an den Klett-Verlag, an Westermann, an Urban & Schwarzenberg und an Scriptor Athenäum (damals ein selbstständiger Verlag in Königstein/Ts.). Alle vier Verlage wollten das Manuskript drucken. Ich habe dann den Redakteuren einen gemeinsamen Brief geschrieben und erklärt, dass ich jenem Verlag die Rechte geben werde, der den niedrigsten Ladenendpreis bietet.[77] Scriptor machte mit deutlichem Abstand das Rennen.[78]



Seither bin ich mit dem damals zuständigen Redakteur von Athenäum Scriptor und heutigen Verlagsleiter Horst Linder von CORNELSEN SCRIPTOR befreundet. Im Jahr 2007 habe ich eine gründliche Überarbeitung des Buchs vorgenommen. Inzwischen gibt es auch eine chinesische Ausgabe.
Der Leitfaden verkaufte sich zur Freude von Horst Linder gut und zog langsam in die Seminare der Zweiten Phase ein. Damals war das Buch im Vergleich zu den in akademisch-anspruchsvollem Stil geschriebenen Didaktiken von Klafki, Derbolav, Geisler, Heimann u.a. im Blick auf seine Praxisnähe fast konkurrenzlos. Im Vorwort der achten Auflage habe ich aber vorsichtshalber geschrieben: „Hohe Auflagenzahlen sind kein Qualitätsnachweis. Aus der Auflagenhöhe der BILD-Zeitung folgere ich nicht auf die Qualität dieser Zeitung, wohl aber, dass sie ein Bedürfnis befriedigt.“
Feiertagsdidaktik? Im „Leitfaden“ werden Wolfgang Klafki, Gunter Otto und Wolfgang Schulz sowie Christine Möller, also führende Köpfe der damaligen Allgemeindidaktik, als „Feiertagsdidaktiker“ verspottet. Wolfgang Klafki konnte mit diesem Urteil eines jungen Spunds problemlos umgehen. Wolfgang Schulz war, wie er mir später sagte, richtig verärgert und hat einen ganzen Aufsatz geschrieben, um meine Attacken zurecht zu rücken. Das hat ihn aber nicht gehindert, mir das Du anzubieten, als wir zusammen Mitherausgeber der Enzyklopädie Erziehungswissenschaft (s.u.) geworden waren. Heute würde ich solch eine Kritik an Feiertagsdidaktiken nicht noch einmal wiederholen, weil in den jüngsten Veröffentlichungen von mir (und Carola Junghans) ein deutlich höheres Niveau der Selbstreflexivität der Studierenden und Referendar*innen gefordert wird – keine leichte Kost für Anfänger*innen. Wir stehen aber dazu, weil die Ansprüche an reflektiertes Lehrerhandeln in den letzten 40 Jahren stark angestiegen sind. Vor 35 Jahren war ich frohgemut an die Arbeit gegangen. In der Einleitung des Leitfadens hatte ich geschrieben: „Man kann lernen, gut zu unterrichten. Man kann erst recht lernen, seinen Unterricht gut vorzubereiten.“ Das ist auch heute noch meine Position – aber die Ansprüche an das Reflexionsvermögen der Studierenden und Referendar*innen sind, wie gesagt, gestiegen.
Kritiken: Die bissigste Kritik zum Leitfaden und auch zu meinen weiteren Veröffentlichungen kam und kommt von meinem Mitdoktoranden und eigenen Diplom-Pädagogik-Absolventen Andreas Gruschka (inzwischen emeritierter Hochschullehrer in Frankfurt/M.). Ich hatte ihn im Kollegschulversuch in Münster kennengelernt. Andreas schrieb, ich sei ein „Totengräber der Didaktik“ und fast so schlimm wie Heinz Klippert. Seine Begründung lautet, ich nähme den Leser*innen das eigene Denken ab und reformuliere nur mundgerecht, was diese eh in ihrem Erfahrungsschatz gespeichert hätten. Das sehe ich nicht so, auch wenn ich gern zugestehe, dass ein akademisch er Disput über Gütekriterien von Ratgeberliteratur überfällig ist. Der sollte dann aber möglichst empirisch abgesichert werden und nicht nur der Reproduktion der Kernaussagen der an Adorno orientierten „Negativen Pädagogik“ von Andreas dienen (Gruschka 1988).
Viel Feind, viel Ehr: Verbotsversuch des Niedersächsischen Kultusministers! Die universitätsinterne Vorausversion dieses Buches wurde dem von mir ansonsten geschätzten damaligen CDU-Kultusminister Werner Remmers von Gymnasialdezernenten aus der Bezirksregierung Osnabrück (alle mit gleichem Parteibuch) zugespielt und scharf kritisiert.[79] Daraufhin erhielt der damalige Rektor der Universität Oldenburg, Rainer Krüger, eine auch in diesen hitzigen Zeiten ungewöhnliche Weisung, in der er aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass mein Text nicht in der Lehramtsausbildung an der Universität Oldenburg eingesetzt werde. Dies wies der Rektor mit Hinweis auf die durch das Grundgesetz garantierte Freiheit von Forschung und Lehre zurück.
Auch im Landtag wurde über den Leitfaden debattiert. Werner Remmers kritisierte ihn; Rolf Wernstedt, späterer SPD-Kultusminister, damals aber noch als Bildungsfachmann der SPD-Fraktion in der Opposition, verteidigte ihn. Ich hörte dann 1980 einen Vortrag von Remmers auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft in Göttingen an. Er hielt ein flammendes Plädoyer für sein Konzept der Erlassfreien Schule. Nach dem Vortrag traute ich mich zu ihm zu gehen und fragte ihn, warum er diesen Erlass an meinen Rektor geschickt habe. Seine Antwort: „Nehmen Sie das nicht zu persönlich! Ich war da von mächtigen Gruppierungen abhängig.“
Namensstreit – auch auf dem Leitfaden! Die Uni wollte sich 1974 den Namen Carl von Ossietzky Universität geben, weil dieser Friedensnobelpreisträger ganz in der Nähe im KZ Esterwegen gesessen hatte und gequält worden war. Die Namensgebung wurde aber von der Landesregierung verboten. Ich hatte mich bewusst und in Absprache mit dem Verlag darüber hinweggesetzt und auf der Rückseite des Leitfadens drucken lassen: „Hilbert Meyer, Professor für Schulpädagogik an der Carl von Ossietzky Universität“. Da erhielt ich vom damaligen persönlichen Referenten des Kultusministers Ansgar Holzknecht einen im Ton höflichen, aber in der Sache harten Brief, in dem er schrieb, dass mir dies nicht zustünde. Ich habe in weiteren Auflagen aber keine Änderung des Buchrückens vorgenommen!
(3) „Unterrichtsmethoden“ (1987): Während meines Studiums und auch in der Promotionsphase haben mich Methodenfragen nicht interessiert. Das änderte sich, als ich 1975 in Oldenburg sah, ein wie wichtiger Baustein professionellen Lehrer*innenhandelns dies ist. Seither ist die Unterrichtsmethodik mein Leib- und Magenthema.
Grundlage der zwei bei Cornelsen Scriptor erschienenen Bände waren Vorlesungen zum Thema „Unterrichtsmethoden“, die ich im Wintersemester 1981/82 das erste Mal gehalten und dann im Mai 1982 in Buchform gemeinsam mit den beiden Hilfskräften Eva Pilz und Karsten Friedrichs im Zentrum für pädagogische Berufspraxis der CvO Uni herausgebracht habe.
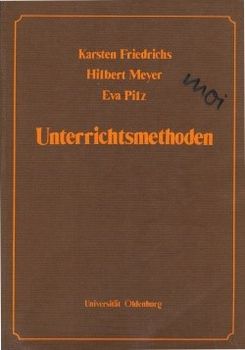

1982: Karsten Friedrichs, Eva Pilz und ich feiern das Erscheinen des Methodenbuchs
Nach mehreren Vorlesungsdurchgängen schwollen die Skripte immer mehr an und es entstand die 1987 zweibändige Verlagsausgabe:
- Der Theorieband liefert eine systematische Rekonstruktion des Methodenbegriffs.
- Der Praxisband beschreibt das methodische Handwerkszeug von Lehrer*innen.
Damals gab es, wie in der Neuauflage aus dem Jahr 2022 (2022, S. 199 f.) analysiert wird, eine geradezu übersprudelnde Theoriediskussion über das Phänomen „Unterrichtsmethode“. Zu Beginn der 90er Jahre ist diese Diskussion abrupt beendet worden. Seither hat es keine einzige Monografie zur Theorie der Methode mehr gegeben. Aber für die Ausbildungspraxis in den Lehrämtern hat das Thema unverändert eine hohe Relevanz.




Die Buchdeckel der Reihe nach: 1. Aufl. 1987, 10.-16. Aufl. 2002 bis 2021; japanische Ausgabe 1998; chinesische Ausgabe 2011
 Im Jahr 1982, als ich mich in das Themengebiet einarbeitete, fiel mir auf, dass westdeutsche Didaktiker wie Wolfgang Klafki, Wolfgang Schulz oder Rainer Winkel in ihrer unterrichtsmethodischen Begrifflichkeit ungenau und unvollständig waren. Herwig Blankertz schenkte mir dann die bei Fischer Athenäum erschienene westdeutsche Lizenzausgabe von Lothar Klingbergs „Einführung in die Allgemeine Didaktik“ und ich war überrascht: Kein anderer Autor war, was die Begriffsbildung und Systematisierung der Unterrichtsmethodik angeht, präziser. Deshalb wandte ich mich an ihn um Rat und war sehr dankbar, dass er die Entstehung dieses Buches begleitete und viele Kapitel minutiös kommentiert und kritisiert hat. Daraus ist bis zu seinem Tod im Jahr 1999 eine Freundschaft entstanden, für die ich bis heute dankbar bin.
Im Jahr 1982, als ich mich in das Themengebiet einarbeitete, fiel mir auf, dass westdeutsche Didaktiker wie Wolfgang Klafki, Wolfgang Schulz oder Rainer Winkel in ihrer unterrichtsmethodischen Begrifflichkeit ungenau und unvollständig waren. Herwig Blankertz schenkte mir dann die bei Fischer Athenäum erschienene westdeutsche Lizenzausgabe von Lothar Klingbergs „Einführung in die Allgemeine Didaktik“ und ich war überrascht: Kein anderer Autor war, was die Begriffsbildung und Systematisierung der Unterrichtsmethodik angeht, präziser. Deshalb wandte ich mich an ihn um Rat und war sehr dankbar, dass er die Entstehung dieses Buches begleitete und viele Kapitel minutiös kommentiert und kritisiert hat. Daraus ist bis zu seinem Tod im Jahr 1999 eine Freundschaft entstanden, für die ich bis heute dankbar bin.
Inzwischen sind vom Praxisband mehr als 300.00 und vom Theorieband mehr als 200.000 Exemplare gedruckt. Die japanische Ausgabe hatte 2 Auflagen, die chinesische mehrere Nachdrucke. Nun, nach 35 Jahren, war aber eine Neuauflage überfällig, die ich gemeinsam mit meiner früheren Studentischen Hilfskraft und jetzigen Seminarleiterin Carola Junghans vorgenommen habe (Meyer & Junghans 2021; 2022).
(4) „Didaktische Modelle“ (1991/2002): Der inzwischen auch schon in den Ruhestand gegangene Frankfurter Musikpädagoge Werner Jank hat von 1991 bis 1994 in Oldenburg Musik studiert. Seine Partnerin und jetzige Frau, Gaby Schröter-Jank, studierte bei mir und sagte zu ihm: „Geh auch mal zu Hilbert!“ Das tat er dann auch und wir vereinbarten gleich, dass er eine Stelle als Wissenschaftliche Hilfskraft erhielt und mit mir gemeinsam die Vorlesung „Einführung in die Allgemeine Didaktik“ hielt. Wir haben versucht, für Studierende und Referendare einen Überblick über den damals aktuellen Stand der Didaktik zu liefern. Die Deckblätter der Reihe nach: die Uni-Ausgabe 1990; die erste Cornelsen-Scriptor-Ausgabe 1991, die 5. überarbeitete und gekürzte Auflage 2001 und die dänische Übersetzung 2003:




Wir haben uns in der Konzeption des Buchs stark an Herwig Blankertz’ „Theorien und Modelle der Didaktik“ (1969) orientiert, dann aber durch neue Textsorten, durch Grafiken und anderes mehr die Verständlichkeit zu erhöhen versucht, aber auch eine deutliche thematische Ausweitung vorgenommen. So gibt es neue Kapitel zum Kompetenzerwerb, zum Lernbegriff, zur Konstruktivistischen Didaktik und zum Handlungsorientierten Unterricht. Die ersten drei Kapitel sind von Michael Uljens (Vaasa/Finnland) ins Schwedische übersetzt worden.
(5) „Was ist guter Unterricht?“ (2004): Dies ist das einzige Buch, das ich eigentlich gar nicht schreiben wollte. Das kam so: Ich hatte Horst Linder empfohlen, nach der deutschen PISA-Misere vom Jahr 2000 ein Buch zum Thema „Unterrichtsqualität“ zu veröffentlichen. Und ich habe ihm auch gleich zwei Autorenvorschläge gemacht. Der erste Vorschlag: Andreas Helmke, damals an der Uni Landau tätig. Aber Andreas Helmke hatte da gerade seinen Vertrag mit Klett-Kallmeyer für das Buch „Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität“ unterschrieben; 2003 ist es dann auch dort erschienen.  Der andere von mir vorgeschlagene Autor machte ein Exposé für den Verlag, dem gemäß das Buch zu zwei Dritteln aus historischen Analysen zur Entwicklung des Qualitätsverständnisses von der Reformpädagogik bis heute bestehen sollte. Das wollte der Verlag nicht haben. Deshalb kam Horst Linder zu mir und sagte: „Dann musst du das Buch schreiben!“ – Und so ist es dann auch gekommen.
Der andere von mir vorgeschlagene Autor machte ein Exposé für den Verlag, dem gemäß das Buch zu zwei Dritteln aus historischen Analysen zur Entwicklung des Qualitätsverständnisses von der Reformpädagogik bis heute bestehen sollte. Das wollte der Verlag nicht haben. Deshalb kam Horst Linder zu mir und sagte: „Dann musst du das Buch schreiben!“ – Und so ist es dann auch gekommen.
Ich wollte das Buch „Merkmale guten Unterrichts“ nennen. Horst Linder hielt das für zu defensiv und sagte: „In deinem gesetzten Alter kannst du ruhig etwas vollmundiger werden. Ich schlage vor: Was ist guter Unterricht?“
Vorläufer für das Buch war erneut ein Seminar, in dem ich zehn Teams gebildet hatte. Jedes Team musste eines der zehn Merkmale bearbeiten. In diesem Buch habe ich erstmalig versucht, mich auch stärker auf die empirische Unterrichtsforschung einzulassen. Beim Leitfaden und bei den Unterrichtsmethoden war das noch nicht der Fall, weil es damals diese empirische Forschung nur erst ansatzweise gab und weil ich die wenigen Ansätze nicht rezipiert hatte.
Dies ist das Buch, von dem es die meisten Übersetzungen in fremde Sprachen gibt:





Dänemark (2005) Kroatien (2005) China (2011) Korea (2011) Ägypten (2015)
Ich war und bin bis heute über die Resonanz auf dieses Buch überrascht. Offensichtlich sind es viele Lehrer*innen leid, immer nur auf PISA-Defizite hingewiesen zu werden. Sie wollen handfest gesagt bekommen, welche Kriterien für den Autor wichtig sind. Und sie nehmen dankbar zur Kenntnis, dass das Buch kein Rezepte-, sondern ein Kriterienkatalog ist, der unterschiedlich umgesetzt werden kann und muss. Im nächsten Jahr (2023) will ich an die Überarbeitung dieses Buches gehen.
(6) Zwei Bücher mit Berufsbildungsbezug: Gemeinsam mit meiner früheren Doktorandin Catherine Walter-Laager habe ich im Cornelsen-Verlag im Jahr 2012 einen Leitfaden  für die Ausbildung von Erzieher*innen veröffentlicht, in dem der elementarpädagogische Fachverstand von der früheren Erzieherin und jetzigen Elementarpädagogin der Uni Graz (Österreich) eingebracht wurde, während ich eine Kompilation aus meinen Büchern Unterrichtsmethoden, Didaktische Modelle und Guter Unterricht beigetragen habe. Das Foto auf dem Buchdeckel finde ich übrigens suboptimal: Es zeigt fünf Erzieherinnen,
für die Ausbildung von Erzieher*innen veröffentlicht, in dem der elementarpädagogische Fachverstand von der früheren Erzieherin und jetzigen Elementarpädagogin der Uni Graz (Österreich) eingebracht wurde, während ich eine Kompilation aus meinen Büchern Unterrichtsmethoden, Didaktische Modelle und Guter Unterricht beigetragen habe. Das Foto auf dem Buchdeckel finde ich übrigens suboptimal: Es zeigt fünf Erzieherinnen, die hingebungsvoll zum männlichen Dozenten blicken – das verstärkt, sicherlich unbeabsichtigt, die Rollenklischees.
die hingebungsvoll zum männlichen Dozenten blicken – das verstärkt, sicherlich unbeabsichtigt, die Rollenklischees.
Auch das 2013 gemeinsam mit der Hannoveraner Pflegedidaktikern Uta Oelke veröffentlichte Buch Didaktik und Methodik in Pflege- und Gesundheitsberufen (inzwischen im fünften Nachdruck) ist ähnlich konzipiert: Auch hier stammen die pflegedidaktischen Anteile vollständig aus der Feder von Uta, während ich meinen allgemeindidaktischen Fachverstand eingebracht habe.
8.3 Beifang
Nicht alle Publikationen wurden im Cornelsen-Verlag veröffentlicht. Es gab, wie die Fischer an der Nordseekünste sagen, hin und wieder Beifang: Bücher, die ich in anderen Verlagen veröffentlicht habe, die aber einen deutlich engeren Adressatenkreis als die Cornelsen-Bücher hatten.
(1) Im Kösel-Verlag München ist 1971 mein erstes Buch erschienen: Curriculumrevision: Möglichkeiten und Grenzen (gemeinsam mit Frank Achtenhagen, siehe Abschnitt 4.1);  ein Jahr später im selben Verlag meine Dissertation (siehe Abschnitt 4.4).
ein Jahr später im selben Verlag meine Dissertation (siehe Abschnitt 4.4).
(2) Im Klett-Cotta-Verlag erschien 1983 der Band 3 der Enzyklopädie Erziehungswissenschaft mit dem Bandtitel „Ziele und Inhalte von Erziehung und Unterricht“ (gemeinsam herausgegeben mit Hans-Dieter Haller). – Eine zeitaufwändige Arbeit, die unter der Gesamtleitung meines damaligen Münsteraner Mitassistenten Dieter Lenzen von 1983 bis 1987 im Klett-Cotta-Verlag veröffentlicht wurde.
 (3) Im Jahr 2007 erschien das FRIEDRICH-Jahresheft XXV: Guter Unterricht, Maßstäbe und Merkmale – Wege und Werkzeuge. Herausgegeben von Andreas Feindt, Hilbert Meyer, Martin Rothland u.a. Die Friedrich-Jahreshefte werden allen Abonnent*innen einer im Friedrich-Verlag erscheinenden Zeitschrift als Jahresgabe geschenkt. Deshalb haben die Jahreshefte eine hohe Auflage und mutmaßlich auch eine entsprechende Resonanz.
(3) Im Jahr 2007 erschien das FRIEDRICH-Jahresheft XXV: Guter Unterricht, Maßstäbe und Merkmale – Wege und Werkzeuge. Herausgegeben von Andreas Feindt, Hilbert Meyer, Martin Rothland u.a. Die Friedrich-Jahreshefte werden allen Abonnent*innen einer im Friedrich-Verlag erscheinenden Zeitschrift als Jahresgabe geschenkt. Deshalb haben die Jahreshefte eine hohe Auflage und mutmaßlich auch eine entsprechende Resonanz.
(4) Im selben Jahr 2007 erschien das gemeinsam mit meinem  Zwillingsbruder Meinert Meyer geschriebene Buch: Wolfgang Klafki – Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? Auslöser für dieses Buch war der Tatbestand, dass wir beide aufgefordert waren, für die 2004 erfolgte Ehrenpromotion von Wolfgang Klafki an der Uni Kassel eines der zwei erforderlichen Gutachten zu schreiben.
Zwillingsbruder Meinert Meyer geschriebene Buch: Wolfgang Klafki – Eine Didaktik für das 21. Jahrhundert? Auslöser für dieses Buch war der Tatbestand, dass wir beide aufgefordert waren, für die 2004 erfolgte Ehrenpromotion von Wolfgang Klafki an der Uni Kassel eines der zwei erforderlichen Gutachten zu schreiben.
(5) Im Jahr 2021 erschien das Buch Bildung gegen Spaltung. Wir wollten ein Signal setzen,  dass endlich radikale Schritte zur Schulreform gegangen werden müssen. Leider sind die Koautorinnen Annemarie von der Groeben und Susanne Thurn, beide Laborschullehrer*innen, kurz nach der Veröffentlichung verstorben. Nun ist diese Streitschrift ihr Vermächtnis. In diesem Band plädieren wir für eine stärkere Individualisierung, fordern den Aufbau der dazu erforderlichen Didaktik der Vielfalt und übernehmen aus der Laborschul-Didaktik die Idee der Stufenkoffer der Bildung.
dass endlich radikale Schritte zur Schulreform gegangen werden müssen. Leider sind die Koautorinnen Annemarie von der Groeben und Susanne Thurn, beide Laborschullehrer*innen, kurz nach der Veröffentlichung verstorben. Nun ist diese Streitschrift ihr Vermächtnis. In diesem Band plädieren wir für eine stärkere Individualisierung, fordern den Aufbau der dazu erforderlichen Didaktik der Vielfalt und übernehmen aus der Laborschul-Didaktik die Idee der Stufenkoffer der Bildung.
Fazit: Es sieht bei flüchtigem Hinsehen so aus, als ob ich pausenlos Bücher geschrieben hätte. Aber der Eindruck täuscht. Bis ein neues Lehrbuch fertig war, habe ich immer mindestens fünf Jahre lang daran gearbeitet.
8.4 Zeichnungen
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die große Mehrzahl der vielen Zeichnungen in meinen Büchern stammt von Karsten Friedrichs, der 1982 als Studentische Hilfskraft geholfen hat, die erste Fassung der Skripte für meine Vorlesung Unterrichtsmethoden herzustellen (s.o.). Karsten wurde dann Studienrat mit den Fächern Kunst und Deutsch an der Liebfrauenschule in Oldenburg. Er wohnt bei mir „um die Ecke“. Für mich war und ist das eine optimale Situation: Wenn ein neues Buch entsteht, gehe ich immer wieder mit ganz groben Skizzen zu ihm und sage: „Kannst du diese Unterrichtssituation zeichnen?“ „Kannst du ein Kollegium in der Gesamtkonferenz zeichnen, von dem ein Drittel kurz vorm Einschlafen ist?“ Oder nenne ihm einfach nur ein Thema. Und dann kommt über kurz oder lang eine Zeichnung, die den Auftrag einlöst. Z.B. der Cartoon zu dem Auftrag: „Zeichne doch mal etwas zur Dialektik der Unterrichtsmethodik!“ – Das sind dann die zwei kleinen Zeichnungen auf dem Deckel der ersten Auflage der „Unterrichtsmethoden“ geworden (s.o., S. 86)
Zeichnungen in meinen Büchern stammt von Karsten Friedrichs, der 1982 als Studentische Hilfskraft geholfen hat, die erste Fassung der Skripte für meine Vorlesung Unterrichtsmethoden herzustellen (s.o.). Karsten wurde dann Studienrat mit den Fächern Kunst und Deutsch an der Liebfrauenschule in Oldenburg. Er wohnt bei mir „um die Ecke“. Für mich war und ist das eine optimale Situation: Wenn ein neues Buch entsteht, gehe ich immer wieder mit ganz groben Skizzen zu ihm und sage: „Kannst du diese Unterrichtssituation zeichnen?“ „Kannst du ein Kollegium in der Gesamtkonferenz zeichnen, von dem ein Drittel kurz vorm Einschlafen ist?“ Oder nenne ihm einfach nur ein Thema. Und dann kommt über kurz oder lang eine Zeichnung, die den Auftrag einlöst. Z.B. der Cartoon zu dem Auftrag: „Zeichne doch mal etwas zur Dialektik der Unterrichtsmethodik!“ – Das sind dann die zwei kleinen Zeichnungen auf dem Deckel der ersten Auflage der „Unterrichtsmethoden“ geworden (s.o., S. 86)
Karstens Spezialität war und ist die Herstellung von Kopfzeichnungen (Portraits). Auch für die Vorwörter meiner Bücher hat er Kopfzeichnungen produziert. Die folgenden vier Zeichnungen zeigen, wie ich mich in 40 Jahren rein optisch verändert habe:




HM 1982 HM 1989 HM 1991 HM 2019
Köpfe wie Karsten zeichnen kann ich nicht! Meine Spezialität ist das deutlich weniger anspruchsvolle Zeichnen von Igeln, Sonnen, Muscheln und ähnlichem Getier:




Auch die vielen Grafiken in meinen Büchern und die DIDAKTISCHEN LANDKARTEN kommen von mir.
9. Sechzigster Geburtstag (2001) und Emeritierung (2009)
Detlef Spindler, damals Leiter des Zentrums für Berufspraxis, ist eine Woche jünger als ich. Deshalb haben wir beschlossen, unseren 120. Geburtstag am 19. Oktober 2001 gemeinsam zu feiern. Für die Einladung hat Karsten Friedrichs den passenden Cartoon gezeichnet:
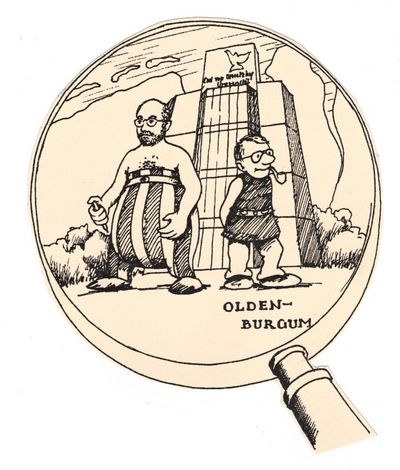
Die grandiose Organisation der Veranstaltung verantworteten Alexandra Obolenski, Andreas Feindt, Ulrike Heinrichs, Ulf Gebken und Carola Junghans:

Emeritierungsfeier 2009: Am 20. Juni 2009 fand in der alten Aula der Universität, in der ich 1963/64 schon als Student Vorlesungen gehört hatte, meine Emeritierungsfeier statt, organisiert und gestaltet von Sylvia Jahnke-Klein, Carola Junghans, Andreas Feindt, Volker Wendt, Ulrike Heinrichs und vielen weiteren netten Menschen.
Der AStA der Uni hatte vorher höflich bei mir angefragt, ob er während der Feier vom Balkon der Aula ein Transparent herabfallen lassen könne, auf dem die Fakultätspolitik des Dekans angeprangert würde. Ich habe freudig zugestimmt und gesagt: “Prima! So komme ich am Tag der Emeritierung zurück zu den turbulenten Anfängen meines Promotionsstudiums an der FU Berlin!“

Noch heute treffe ich auf Kolleg*innen, die mir sagen, wie genial diese Fünf die Feier gestaltet haben: Sie wollten meinen Grundsatz der Handlungsorientierung des Unterrichts auf eine Uni-Feier übertragen – und das ist ihnen wirklich gelungen! Es gab, wie in jeder meiner Vorlesungen, einen großen FAHRPLAN, diesmal zum Thema „Lehrerbildung in 6 Akten“:

Der auf der Bühne der Aula aufgestellte FAHRPLAN der Emeritierungsfeier
Die einzelnen Stationen:
- Astrid Kaiser, damals die Institutsdirektorin, eröffnete die Veranstaltung; und die Vizepräsidentin, Frau Ahrens, hielt ein Grußwort.
- Der Dekan unserer Fakultät, der Soziologe Bernhard Kittel, hielt eine kurze Ansprache, in der er erklärte, ich hätte es in den Jahren 1975 bis 2009 ja noch gut gehabt. Heute sei die Arbeit viel anspruchsvoller geworden! Dem hat dann Klaus-Jürgen Tillmann, der nach dieser Eröffnung auf dem Podium eine Diskussion über Lehrqualität führte, heftig widersprochen – was mich gefreut hat!
- Hilfskräfte-Chor: Eine Inszenierung der 35 aktuell oder in früheren Jahren für mich tätigen Studentischen und Wissenschaftlichen Hilfskräfte, die die Zustände in meinem Büro liebevoll-ironisch kommentierten (insbesondere den Mittagsschlaf auf der Gummimatte unter dem Arbeitstisch).
- Carolas Mann Michael Greiner inszenierte einen Stomp mit allen gut 300 Gästen, bei dem folgende Geräusche im Vier-Vierteltakt von allen Gästen intoniert wurden: die Schreibtischplatte am Sitzplatz beklopfen – mitgebrachte Kladden (wie sie Hilbert immer nutzte) lautstark zusammenklappen – zwei Steine (wie sie jeder Prüfling als Geschenk bekam) aneinander schlagen – mit Löffeln auf Honiggläser schlagen (sie lagen unter dem Sitzplatz; der Grund: Hilbert hat immer wieder den Honig seines Schwagers Wolfgang verschenkt) – und dazu ein Ostinato, von Luise mit Hilberts Klangschale geschlagen.
- Nach den Ansprachen und Inszenierungen hat meine Frau Christa die aus feministischer Sicht erforderlichen Anmerkungen zu solch einer männlichen Wissenschaftlerlaufbahn gegeben.

- Zum Schluss sang der Hilfskräftechor eine umgetextete Fassung von Peter Fox‘ „Haus am See“, bei der alle Gäste mitsingen sollten. Der Chorus nach jeder Strophe:
„Und am Ende deiner Arbeit rein ins Igelhaus/
Kastanienallee, Christa und Pfeifenrauch/
Du hast uns so viel Wertschätzung entgegen gebracht/
ach Hilbert, Dein Vertrauen hat uns stark gemacht/
Wir haben gelernt von deiner Person/
ein biografisches Curriculum!“
Das Mitsingen hat geklappt, wie es das Foto der Uni-Pressestelle belegt:

vordere Reihe v.l.: Andreas Feindt, Carola Junghans, Sylvia Jahnke Klein, Wolfgang Konukiewitz (mein Schwager), Gisela Blankertz (meine Doktormutter), Christa und Hilbert Meyer
Der Chor der Hilfskräfte hat mich besonders erfreut, weil mein ganzes Berufsleben lang gern mit ihnen zusammengearbeitet habe:

Chor der Hilfskräfte – in der ersten Reihe: Rabia Schadel, Friederike Güffens, Reina Freese, Gesche Willerich und Ines Hartog
Fazit:
Ich habe in meinem beruflichen und wissenschaftlichen Werdegang trotz der eingangs erwähnten Einstürzenden Neubauten viel Glück gehabt. Dafür bin ich allen, die mir dies zugestanden haben und die mich in meiner beruflichen und wissenschaftlichen Entwicklung unterstützt haben, aus vollem Herzen dankbar. Einiges ist nicht gelungen. Aus heutiger Sicht fehlt mir eine stabile eigene empirische Forschungspraxis. Andererseits vermute ich, dass ich zu meinen Lehrbüchern niemals gekommen wäre, wenn ich deren empirische Basis erst selbst hätte herstellen müssen.
Beim ersten Aufschreiben dieses Berichts im Jahr 2006 und erst recht beim Überarbeiten in diesem Jahr 2022 sind mir drei Punkte meines beruflichen und wissenschaftlichen Werdegangs bewusst geworden:
(1) Ich habe gemerkt, wie stark die Wertschätzung, die mir mein Doktorvater Herwig entgegengebracht hat, mein Hochschullehrerverhalten geprägt hat. Er hat viel verlangt, aber das Vertrauen geschenkt und deutlich gesagt, dass ich es schaffen werde.
(2) Ich habe registriert, einen wie großen Einfluss mein Zwillingsstatus auf meine persönliche Entwicklung und später auch auf mein wissenschaftliches Arbeiten hatte.
(3) Ich habe erkannt, dass der deutsche Faschismus und das Elend des Zweiten Weltkriegs meinen wissenschaftlichen Werdegang stärker beeinflusst haben, als mir dies im Alter von 20 oder 30 Jahren bewusst gewesen ist.
Carola Junghans, mit der ich zusammen die Neuauflage der zwei Bände „Unterrichtsmethoden“ verfasst habe, schreibt im Theorieband (auf S. 82), dass anspruchsvolle Lernprozesse aus der konstruktiven Verarbeitung von Krisen im persönlichen Entwicklungsprozess bestehen. Ich habe ihr gesagt: „Ich kann mich in meinem eigenen Berufsweg an solche Krisen gar nicht erinnern.“ Darauf Carola: „Du hast sie bloß nicht bemerkt!“
Nachtrag:
Am 20. Mai 2020 bin ich an der Abo Academi University in Turku (Finnland) wegen meines Beitrags zum skandinavischen Didaktikdiskurses zum Dr. honoris causa ernannt worden, ausgelöst durch die langjährige Zusammenarbeit mit Michael Uljens, Faculty of Education and Health Science am Außenstandort in Vaasa.

v.l.n.r.: Dr h.c. HM, Dr. h.c. Jan Masschelein von der Uni Löwen (Belgien); Michael Uljens (host of Hilbert), Siv Björklund (host of Jim), die Rektorin der Außenstelle Vaasa Lisbeth Fagerström, Frau Ann-Katrin Svensson und Dr. h.c. Jim Cummins von der Uni Toronto (Canada).
Die Zeremonie lief noch nach mittelalterlichem Ritus ab: Versammelt waren gut 90 Doktorand*innen und 13 Ehrendoktor*innen  aus fünf Fakultäten, die wegen der Coronapandemie aus zwei Jahren zusammengefasst wurden. Wir mussten einer nach dem anderen nach vorn kommen, dort von der Dekanin/dem Dekan den Doktorhut, einen Degen und die Diplomurkunde in Empfang nehmen und dann eine tiefe Verbeugung vor dem Rektor machen – das hat zweieinhalb Stunden gedauert, in denen nur Lateinisch gesprochen wurde. Hinterher prozessierten die frisch Promovierten gemeinsam durch die Stadt bis zum Dom von Turku, die älteste Kirche in ganz Finnland. Dort fand in schwedischer Sprache ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dem die Rabbinerin der Stadt die Predigt hielt, der evangelische Pastor sowie der katholische und der russisch-orthodoxe Priester die Liturgie machten. Der Universitätschor machte die musikalische Gestaltung. Das Wort „Promotion“ stammt übrigens von diesem Ritus: Im Mittelalter zogen alle, die das Rigorosum bestanden hatten, einmal im Jahr von ihrer Fakultät zum Rektor, um dort ihren Doktortitel und -hut zu empfangen. Übrigens: Die theologische Fakultät in Turku verteilt keinen Degen! Gut so! Ich musste meinen Degen gleich wieder abgeben: Mein neunjähriger Enkel Theo Kasper hat mich so inständig darum gebeten, dass ich nicht widerstehen konnte, ihm den Degen zu schenken.
aus fünf Fakultäten, die wegen der Coronapandemie aus zwei Jahren zusammengefasst wurden. Wir mussten einer nach dem anderen nach vorn kommen, dort von der Dekanin/dem Dekan den Doktorhut, einen Degen und die Diplomurkunde in Empfang nehmen und dann eine tiefe Verbeugung vor dem Rektor machen – das hat zweieinhalb Stunden gedauert, in denen nur Lateinisch gesprochen wurde. Hinterher prozessierten die frisch Promovierten gemeinsam durch die Stadt bis zum Dom von Turku, die älteste Kirche in ganz Finnland. Dort fand in schwedischer Sprache ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dem die Rabbinerin der Stadt die Predigt hielt, der evangelische Pastor sowie der katholische und der russisch-orthodoxe Priester die Liturgie machten. Der Universitätschor machte die musikalische Gestaltung. Das Wort „Promotion“ stammt übrigens von diesem Ritus: Im Mittelalter zogen alle, die das Rigorosum bestanden hatten, einmal im Jahr von ihrer Fakultät zum Rektor, um dort ihren Doktortitel und -hut zu empfangen. Übrigens: Die theologische Fakultät in Turku verteilt keinen Degen! Gut so! Ich musste meinen Degen gleich wieder abgeben: Mein neunjähriger Enkel Theo Kasper hat mich so inständig darum gebeten, dass ich nicht widerstehen konnte, ihm den Degen zu schenken.

Promotion aller Doktorand*innen und doctores honoris causa zum Dom in Turku am 20.5.2022
[1] Wer sich in der Rockszene nicht auskennt, dem sei gesagt, dass es sich bei dieser Formulierung um eine Anspielung auf eine in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts angesagte experimentelle Band handelt.
[2] Ich habe keine grundsätzlichen Einwände gegen die Umstellung auf das BA/MA-System. Sie stärkt die Hochschulautonomie. Was ich aber für katastrophal halte, ist die mit dem ersten Semester einsetzende Punkte-Jagd aufgrund der prüfungsabschichtenden Leistungsnachweise. Die jeweils 450 Klausuren, die wir zu dritt innerhalb einer Woche durchsehen mussten, waren didaktisch gesehen schierer Unsinn! Das aktuell praktizierte Prüfungssystem behindert ein selbstbestimmtes Studium und führt, wie empirisch seit langem belegt ist, bei vielen Studierenden zum Bulimie-Lernen.
[3] Das ist die Nr. 97 aus dem Veröffentlichungsverzeichnis „Aufsätze“ auf meiner UNI-Homepage.
[4] Aktuell z.B. in dem Theorieband Unterrichtsmethoden (gemeinsam mit Carola Junghans, Berlin: Cornelsen 2022).
[5] Das Foto auf der ersten Seite hat Michael Miethe (Berlin) 2009 für den Cornelsen Verlag angefertigt.
[6] Dort ist er gemeinsam mit seinen Waisenhauskindern und seiner Mitarbeiterin Stefania Wilcynska von den Deutschen ermordet worden.
[7] Rolf Hornig (Hrsg.) (1998). Drei Frauen im 20. Jahrhundert. Eine biografische Trilogie aus Westerstede. Westerstede: Pleis Druckerei, S. 108 bis 156
[8] Über diesen Urgroßvater war ich sehr eng mit den Brüdern Gerhard und Ricklef Orth (späterer Rektor meiner ersten Praktikumsschule in Oldenburg) verwandt. Als ich ihnen dies erzählte, waren sie bass erstaunt.
[9] Das hat er nie verschwiegen. Er war deshalb auch tolerant, wenn ich die Zeugnisanmerkung „Versetzung gefährdet“ hatte oder wenn eines meiner Geschwister sitzen blieb. Das habe ich als sehr entlastend empfunden.
[10] In Friedrich Wissmanns Habilitationsschrift findet sich ein Kapitel über dieses Seminar und seinen präfaschistischen Direktor.
[11] In der Arbeit von Alexander Hesse („Die Professoren und Dozenten der Preußischen Pädagogischen Akademien und Hochschulen für Lehrerbildung“, Weinheim 1995, S. 309) wird auf Grundlage der noch erhaltenen Personalakten einiges über den beruflichen Werdegang dieser Dozenten und Professoren und auch über meinen Vater gesagt (siehe den Anhang im Skript „Unsere Fluchtgeschichte“ auf dieser HOMEPAGE).
[12] Sein Chef schrieb in der Stellungnahme zum Vorschlag: „Meyer ist für die Ernennung geeignet, weil er pädagogische Begabung hat.“
[13] ausführliche dargestellt in dem Text „Unsere Fluchtgeschichte“ auf dieser HOMEPAGE.
[14] Nur unsere Großmutter fragte nach unserer Geburt besorgt an, ob es zutreffe, dass Zwillinge von allem nur die Hälfte abkriegen.
[15] Als ich 1964 zu meinem damaligen Oldenburger Hochschullehrer Werner Loch ging und ihm sagte, ich würde gern bei ihm eine Examensarbeit über die Pädagogik des Trampens schreiben, lehnte er das schlichtweg ab und schlug mir vor, die Arbeit über Schleiermachers Pädagogik zu schreiben – ein kluger Ratschlag, den ich beherzigt habe!
[16] Ich hatte am Gymnasium nur eine einzige Lehrerin, die Biologie- und Chemielehrerin Harder Stukenberg.
[17] Die lokale Junge Union kam in die PH und forderte uns auf, die Einladung abzulehnen. Begründung: „Ihr dürft Adenauer nicht in den Rücken fallen!“
[18] Bei diesem Anlass lernte er den führenden Vertreter der Polytechnischen Bildung der DDR, Prof. Hans Joachim Klein kennen und baute eine langjährige Freundschaft zu ihm auf.
[19] Die von uns ausgesprochene Gegeneinladung der FDJler nach Oldenburg wurde angenommen, aber nie realisiert. 1968 traf ich eine der damaligen Ostberliner Student*innen an der Freien Universität Westberlin wieder. Sie gestand, dass sie nur wegen der Hoffnung auf eine Chance zur Republikflucht – wie mehrere andere – in den Reisekader der FDJ eingetreten war. Offensichtlich sah das die Stasi genauso und gab keine Zustimmung zu dieser Reise.
[20] Im Juli 1964 habe ich die Notizen zu einer kleinen Broschüre zusammengefasst.
[21] Die erste schriftliche Note an der PH war damals die sogenannte „Vorexamensarbeit“, die im Hauptfach zu schreiben war. Mein Dozent, Professor Lüschen, sagte in der Sprechstunde kein Wort zur Begründung der Note, merkte aber an: „Sie heulen nicht. Die Studentinnen heulen immer so!“
[22] Damals war es noch nicht möglich, sich aktiv um eine Promotion zu bewerben. Man musste warten, bis man das Angebot eines Hochschullehrers erhielt.
[23] Nach einem Jahr wurde das Deputat auf 25 Stunden verringert. Dafür musste ich aber 14-tägig an einer Seminarsitzung teilnehmen, die vom Schulrat organisiert wurde und deren Leiter mein Ocholter Mentor Walter Spellig war.
[24] Alle Schüler*innen mussten die Deutsch- und Mathehefte doppelt anschaffen, damit ich jeden Tag alle Hausaufgaben kontrollieren konnte.
[25] In Kurzfassung veröffentlicht in der Zeitschrift "Bildung und Erziehung" (1968); nachgedruckt in meinem Band „Türklinkendidaktik“ (2001).
[26] Ich habe die Geschichte dieser Freien Konferenz nie erfahren. Ich vermute, dass die Gründung Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte, als sich der Volksschullehrerstand formierte und als politische Bewegung verstand.
[27] Ich hatte 1964 mit 28 Schüler*innen angefangen, aber weil sehr kleine Schulen in den Nachbardörfern aufgelöst wurden, wurde meine Klasse immer voller.
[28] Ich bin insgesamt dreimal verbeamtet und zweimal aus dem Beamtenverhältnis entlassen worden. Angesichts des damaligen Lehrermangels war das risikolos.
[29] Damals gab es in Berlin ebenso wie 1969 in Münster in der Philosophischen Fakultät nur das sog. grundständige und nicht ein auf ein erstes Examen aufbauendes Promotionsstudium. Grundständig waren zwei Nebenfächer erforderlich, die im Rigorosum auch geprüft wurden.
[30] Neben Herwig Blankertz hatte mir auch Werner Loch (damals Uni Erlangen) dieses Angebot gemacht. Ich habe geschwankt, was für mich sinnvoller sei, mich dann aber klar für Herwig Blankertz entschieden, weil ich den – sicherlich richtigen – Eindruck hatte, bei ihm mehr zur Wissenschaftstheorie und Kritik wissenschaftlichen Arbeitens lernen zu können.
[31] Erst 30 Jahre später haben Andreas Helmke und ich herausbekommen, dass wir beide an diesem Kongress teilgenommen hatten.
[32] Spuren dieser Arbeit finden sich in Blankertz‘ Buch "Bildung im Zeitalter der großen Industrie" (1969). Damals habe ich das erste und einzige Mal in meinem Leben echte Archiv-Arbeit gemacht und die in der FU-Bibliothek vorhandenen Dokumente zum Nationalkonvent während der Revolution studiert (vgl. J. Guillaume (Ed.) (1891-1907). Procès-verbaux du Comité d’Instruction publique de la Convention nationale. 6 Bände: Paris.
[33] Die formalen Gründe für diese Diskriminierung des PH-Studiums habe ich damals und auch heute noch nicht akzeptiert. Das PH-Studium betrug nur 6 Semester und galt und gilt deshalb bis heute nicht als wissenschaftliches Studium!
[34] Eine genauere Analyse der personalpolitischen, curricularen und bildungspolitischen Aktivitäten von Blankertz liefert die Münsteraner Dissertation von Martin Rothland (Erstgutachter: Ewald Terhart).
[35] Auch Wolfgang Klafki, Klaus Mollenhauer, Theodor Schulze, Ilse Dahmer und der Oldenburger Hans-Dieterich Raapke sind Doktorand*innen von Weniger.
[36] Blankertz, Herwig (1978). Handlungsrelevanz pädagogischer Theorie. Selbstkritik und Perspektive der Erziehungswissenschaft am Ausgang der Bildungsreform. In: Zeitschrift für Pädagogik, 24. Jg., S. 171-182.
[37] Im Antwortbrief an van Dick vom 21. 5. 1981 schrieb Blankertz: „In einem jugendlichen Alter, in dem ich nach dem heutigen Recht noch nicht einmal volljährig gewesen wäre, musste ich Soldat in Hitlers Wehrmacht sein und sind mir Entscheidungen zugefallen, die mich fast zerbrochen haben. (…) Gleichwohl folgere ich daraus keinen Pazifismus, sondern Recht und Pflicht des Kampfes gegen Unrecht und Barbarei.“
[38] Was ich nicht getan habe.
[39] Vgl. Hilbert Meyer (1993) In memoriam Herwig Blankertz. In: Herwig-Blankertz-Stiftung der Stadt Recklinghausen in Zusammenarbeit mit der Akademie für Jugend und Beruf, Hattingen S. 13-28
[40] Herwig Blankertz hatte mir zunächst vorgeschlagen, das Deduktionsproblem in einer historischen Analyse zu Pädagogen des 18. Jahrhunderts zu klären. Das fand ich langweilig. Mein Vorschlag, diese Frage auf die damals gerade hoch aktuell gewordene US-amerikanische Curriculumdiskussion zu beziehen, wurde von ihm sofort akzeptiert und nach Kräften unterstützt.
[41] Diese Titel-Generalisierung hat mir dann noch deutliche Kritik von Hartmut von Hentig eingebracht: Zur 500-Jahrfeier der Uni Tübingen hielt er einen Vortrag zur Frage der Praxisrelevanz der erziehungswissenschaftlichen Forschung (veröffentlicht in HvH (1982). Erkennen durch Handeln. Stuttgart: Klett), in dem er meine Dissertation als Musterbeispiel für Praxisirrelevanz kritisierte (a.a.O., S. 35).
[42] Auch heute (2022) ist das die Studierendenzahl. Die Uni Münster war und ist also, was die Immatrikulationszahlen angeht, primär eine Lehrerbildungsanstalt
[43] Ich hatte 1973 beim Düsseldorfer Ministerium eine recht gut bezahlte Angestellten-Stelle (BAT I A) erhalten, weil ich im November 1972 vom Dekan der Pädagogischen Fakultät der Universität Trier-Kaiserslautern aufgefordert worden war, mich auf eine H 4-Stelle zu bewerben, bei der die Bewerbungsfrist bereits abgelaufen war. Darauf bin ich nicht eingegangen, aber Herwig Blankertz hat im Kultusministerium durchgedrückt, dass ich eine höhere BAT-Eingruppierung erhielt.
[44] Das lag auch an der sehr günstigen Bewerbungslage für junge Wissenschaftler*innen (s.u.).
[45] Warum diese Professuren „ordentlich“ heißen, habe ich bis heute nicht herausgefunden. Klar ist, dass die H 3-Professuren und die apl. Professuren nicht unordentlich sind.
[46] Das waren die Religionspädagogin Lenchen Ramsauer, der Mathematikdidaktiker Heinrich Besuden, der Politologe Helmut Freiwald, der mich 1964 in Philosophie geprüft und Ulrich Günther, der mir die Praktikumsnote gegeben hatte.
[47] Tochter der in der Weimarer Republik führenden Sozialpädagogin Lina Mayer-Kulenkampff
[48] Dazu passt, dass er in Zürich, wohin er später wechselte, an der ETH Ärger wegen nicht genehmigter Nebentätigkeiten bekommen hatte.
[49] Einen umfassenden Überblick über das Konzept liefert die von Wolfgang Fichten, Detlef Spindler und Ulrich Steinbrink herausgegebene sechsbändigen „Dokumentation zur Einphasigen Lehrerbildung“, veröffentlicht vom Zentrum für pädagogische Berufspraxis Oldenburg (1981).
[50] Ich habe das ebenso gehalten und bis zu meiner Emeritierung schon in der ersten Vorlesung das „Werkstatt-Du‘“ eingeführt, dann aber gleich angemerkt: „Der sozial mächtigere bestimmt die Verkehrsregeln. Und das bin im Moment ich. Bei Euren Praktika an den Schulen haltet Euch bittschön die dort gültigen Regeln!“
[51] Deshalb habe ich bis heute eine innere Abneigung gegen Unterrichtskonzepte, die die Direkte Instruktion vollständig abschaffen wollen.
[52] Das Seminar fand freitags von 18 bis 20 Uhr statt. Es war gut und regelmäßig besucht.
[53] Es gab also jeweils zwei Veranstaltungen für die Betreuung einer Praktikumsgruppe – doppelt so viel Lehrdeputat wie heute!
[54] Klaus Zierer, mein Lehrstuhlnachfolger im Jahr 2011, hat diese Tafel nach seinem Ausscheiden aus der Uni Oldenburg mitgehen lassen. Sie hängt jetzt in seinem Büro in der Uni Augsburg.
[55] Das viele Urlaubmachen ist ja eine ganz junge Erfindung und keine Selbstverständlichkeit. Meine Eltern, meine Großeltern und ihre Vorfahren machten überhaupt keinen Urlaub! Und auch ich habe mir immer Arbeit in den Urlaub mitgenommen.
[56] Als ich 1989 Dekan unseres Fachbereichs wurde, habe ich eine Vorlage eingebracht, die zeigte, dass „eigentlich“ nur 20 Prozent unserer Lehrkapazitäten in das Diplomstudium Pädagogik hätten einfließen dürfen, dass es de facto aber 40 Prozent waren. Das hieß, dass die vielen Lehramtsstudierenden deutlich benachteiligt wurden. Die Vorlage hat heftige Diskussionen ausgelöst. Friedel Busch, der sich für das Diplomstudium stark machte, sagte in der Fachbereichsratssitzung zu mir: „Du willst doch nicht, dass der Diplomstudiengang geschlossen werden muss?“ – Das wollte ich nicht, aber ich wollte eine gerechte Gleichverteilung des Mangels – und nicht die auch an vielen Unis übliche Bevorzugung der Hauptfachstudierenden.
[57] Von links nach rechts: Wolfgang Fichten (das vom Doktoranden gewählte Mitglied), Una Dirks (Zweitgutachterin aus Hildesheim), Hanna Kiper (Vorsitzende), Andreas Feindt (der gerade von HM einen Sprechstein und eine Klangschale geschenkt bekommt) und Matthias Schierz (Sportdidaktiker und Prüfer des benachbarten Fachs).
[58] Barbara Moschner und ich wetteifern ein wenig, wer von uns beiden zum Datum der Emeritierung mehr Menschen zur Promotion verholfen hat bzw. haben wird.
[59] Eine meiner Doktorand*innen, die ich für das Graduiertenkolleg „Didaktische Rekonstruktion“ (siehe Punkt 7.5) vorgeschlagen hatte und die auf bestem Wege war, eine exzellente Dissertation zur Grundschuldidaktik zu schreiben, hatte sich schon vorher mit einem Partner zusammengetan, der sie anfänglich sehr unterstützte, sich dann aber als Pornoproduzent entpuppte. Er neigte zur Gewalttätigkeit. Er besaß eine Pistole. Er erhielt Hausverbot an der Uni. Er gab pausenlos riesige Geldmengen aus, die er gar nicht hatte. Die Doktorandin sprang ein, verschuldete sich selbst immer mehr und beging dann zu unser aller Entsetzen Suizid. Immer wieder denke ich an diese Doktorandin und frage mich, ob und wie ihr Tod hätte verhindert werden können.
[60] Rainer hätte eigentlich am Institut für die Didaktik der Mathematik an der Uni Bielefeld promovieren müssen – aber das ließ die dortige Promotionsordnung nicht zu. Er hatte „nur“ ein Diplom in Psychologie.
[61] Volker war als Bundeswehrpilot schon mit 42 Jahren entlassen worden, wollte sich aber keinesfalls aufs Altenteil legen und fragte an, ob er bei mir über das Thema „Eigeninitiative in der beruflichen Weiterbildung“ promovieren könne. Was er dann auch getan hat.
[62] Hans Krull wollte eigentlich bei mir nach seiner Pensionierung eine Dissertation zum Thema Prüfungsdidaktik schreiben, hatte auch schon fleißig am Rande der Legalität empirisches Material (Tonbandaufnahmen von Prüfungen) gesammelt, musste dann aber aus Gesundheitsgründen das Projekt abbrechen.
[63] In einer Fachprüfung Mathematik für das Gymnasiallehramt sagte der Prof plötzlich: „Ach nee, diese Frage ziehe ich zurück. Das ist nur etwas für Diplom-Prüfungen!“ Er signalisierte mit der Frage sein Lehramts-Vorurteil und wusste nicht, dass dieser Student schon ein Mathe-Diplom hatte.
[64] Aus der Universitätsschule ist nichts geworden. Ich hatte den Kultusminister Rolf Wernstedt darauf angesprochen. Er sagte: „Ja, macht das mal!“ Auf die Anschlussfrage: „Welche finanzielle Ausstattung bekommen wir dafür?“ musste er antworten: „Keine!“ Damit war die Idee bis auf weiteres begraben. Aber vielleicht gelingt es ja im neuen Jahrhundert.
[65] Hilbert Meyer & Wolfgang Fichten (2009). Einführung in die schulische Aktionsforschung. Ziele, Verfahren und Ergebnisse eines BLK-Modellversuchs. Oldenburger VORDRUCKE Nr. 581. Oldenburg: Didaktisches Zentrum der Universität. (93 Seiten).
[66] Renate Klingberg hat mir einmal berichtet, um welche Erfahrungen es ging. Und Lothar hat durch Kopfnicken die Aussage bestätigt: Lothar war als 17Jähriger zu einer Pioniereinheit eingezogen worden, die in Tschechien in den letzten Kriegsmonaten von einer Partisanengruppe gefangen genommen worden war. Die 18 oder 19 Soldaten mussten sich dem Alter nach aufstellen. Dann wurde einer nach dem anderen erschossen. Lothar als Jüngster wurde aufgefordert, wegzulaufen. Er war sich sicher, dass er dann beim Weglaufen erschossen werden sollte. Aber sie ließen ihn als einzigen laufen – vielleicht, weil sie wollten, dass sich das Schicksal der anderen in der Kriegsregion herumsprach. Seit diesem Ereignis hatte Lothar eine massive Herzerkrankung.
[67] Neulehrer wurden in der sowjetischen Besatzungszone zum Teil ohne jede Ausbildung eingesetzt, um aktive Parteigänger des Nationalsozialismus abzulösen. Lothar hat zeitlebens enge Kontakte zu seiner ersten Klasse gehabt. Ein Drittel dieser ersten Schulklasse aus Otterwisch erschien 45 Jahre später zu Lothars Beerdigungsfeier (an der ich ebenfalls teilnehmen konnte und eine kurze Ansprache gehalten habe).
[68] Erst nach der Wiedervereinigung konnte Lothar Einsicht in die Akten seines Habilitationsverfahrens an der Uni Leipzig nehmen und hat dann gesehen, dass ein Kollege Einspruch in seinem Verfahren erhoben hatte, weil er den bürgerlichen Pädagogen Johann Friedrich Herbart dessen Auffassung nach zu unkritisch rezipiert hatte.
[69] Die Lebensdaten von Klingberg sind auf der Homepage der Universität Leipzig zu finden. Darin werden sein erstes, kriegsbedingt abgebrochenes Studium an Lehrerbildungsanstalten in Schlesien, der Einsatz in den letzten Kriegsmonaten des Jahres 1945 in einem Bataillon der Waffen-SS, die Zeit als Neulehrer, das Studium an der Uni Leipzig und die Stationen als Professor in Leipzig und Potsdam skizziert.
[70] Aufgrund dieses Kontakts war ich dann auch bei der letzten erweiterten Promotionsprüfung (Habilitation) der APW als Gutachter dabei; die erfolgreiche Kandidatin: Petra Stephan.
[71] Nach der Wiedervereinigung hat mir Elisabeth Kopien der diversen Aktennotizen und Anweisungen geschickt.
[72] Nur der Westdeutsche Rainer Winkel fiel unangenehm auf, weil er in der von ihm hospitierten Grundschulklasse die Schüler*innen aufforderte, ein FDJ-Lied zu singen. Die Klassenlehrerin kam dann hinterher heulend zu Elisabeth. Sie fühlte sich in ihrem ernsthaften Reformwillen dupiert.
[73] Bei der ersten Kontaktaufnahme in Oldenburg sagte der Referent des Vorsitzenden, man wolle die IG-Metall-Bildungsarbeit „entstalinisieren“ – eine markige Formulierung, die mich herausforderte.
[74] Mit Lothar Wentzel, der im IG-Metall-Vorstand in Frankfurt/M. für die Bildungsarbeit zuständig ist und aus Oldenburg stammt, bin ich bis heute befreundet.
[75] Dann werde ich ab und an gefragt, ob ich durch die Buchhonorare zum Millionär geworden sei. Ich antworte dann: „Mitnichten! Ich habe einen sehr schönen Zuverdienst, aber das ist immer noch deutlich weniger als das, was ein doppelt verdienendes Lehrer- oder Hochschullehrer-Ehepaar jedes Jahr zur Verfügung hat!“ Ich habe den Zusatzverdienst genutzt, um vier Kinder studieren zu lassen und um das Wohnhaus in der Kastanienallee in Oldenburg Schritt für Schritt abzubezahlen. Der Verkaufserfolg gilt aber nicht für alle Bücher: Die zwei Bände zur „Schulpädagogik“ (1997) und das Buch „Unterrichtsentwicklung“ (2015) hatten bzw. haben sehr bescheidene Verkaufszahlen.
[76] Einmal kam in einer Lehrplankommission des Kollegschulversuchs ein Griechisch-Lateinlehrer zu mir und fragte: „Kommt das Wort Operationalisierung von opus und ratio?“ (Dass dem nicht so ist, hätte sich ein Altphilologe auch selbst ausrechnen können!)
[77] Das klingt sehr selbstlos, war es aber gar nicht. Ich hatte schon das Kalkül, dass sich ein preiswertes Buch besser und länger verkauft.
[78] Die erste Auflage kostete 12,80 DM, ein Preis, der nur möglich war, weil der Verlag so risikobereit war, in der ersten Auflage gleich 20.000 Exemplare zu drucken. Urban & Schwarzenberg wollten dass Buch für 18 oder 19 DM anbieten; Klett für das Doppelte des Scriptor-Angebots.
[79] Es hatte einen Raubdruck von Teilen meines „Leitfadens“ am Zentrum für Lehrerbildung der Uni Osnabrück gegeben, den die Osnabrücker Dezernenten gelesen hatten. Sie monierten u.a. die Aussage, dass in der Schule nur entfremdetes Lernen möglich sei. Sie vermuteten zu Recht, dass solch ein Begriff eine von Karl Marx hergeleitete Bedeutung habe.

