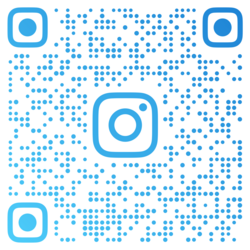Die nächste Institutsratssitzung und Institutsvollversammlung findet am 21.01.2026 statt.
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik
Kontakt
Direktorin
Geschäftsstelle
Gremien
Koordinator des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik
(Informationen, Beratung & Feedback)
Fachschaft Sonder- und Rehabilitationspädagogik
Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik

Herzlich willkommen auf den Seiten des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik!
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über das Institut mit allen wichtigen Informationen zu Forschung, Lehre & Studium und Internationalisierung. Unter Einrichtungen finden Sie außerdem Angebote für Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen sowie Informationen zur KoggE, unserem inklusiven Kompetenzzentrum für die gemeinsame, ganzheitliche Entwicklungsförderung im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Darüber hinaus stellen sich die Fachgruppen mit ihren Teams und den jeweiligen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten vor.
Wir freuen uns über Anregungen und stehen als Institut gerne bei Fragen zur Verfügung.