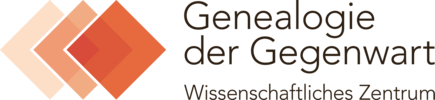Koordination
Projektförderung
Laufzeit
April 2019 bis März 2023
Teilprojekte
Zwischen Befreiung und Unterwerfung, Eskapismus und Pioniergeist
Zwischen Befreiung und Unterwerfung, Eskapismus und Pioniergeist.
Ambivalenzen der Subjektivierung im Kontext gemeinschaftlicher Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsentwürfe
Bearbeitung: Dr. Steffen Hamborg
Leitung: Prof. Dr. Thorsten Raabe
Gemeinschaftsprojekte erscheinen heute in vielfacher Hinsicht als verheißungsvolle Entwürfe zur Bearbeitung krisenhafter Verhältnisse in der Wachstumsgesellschaft. Nicht zuletzt die prominente Anrufung als ‚Pioniere des Wandels‘, die neben die altbekannte Figur des ‚Aussteigertums‘ hinzugetreten ist, verleiht dieser gesellschaftlichen Projektion ihren diskursiven Ausdruck. Als (Sehnsuchts)Orte eines solidarischen Miteinanders wecken ‚alternative‘ Gemeinschaften etwa Hoffnungen auf eine (zumindest partielle) Befreiung von den ökonomischen Zwängen des Wachstumskapitalismus, auf eine Verringerung bis Aufhebung sozialer und ökologischer Destruktivität, auf Möglichkeiten der direkten Mitsprache bei der Organisation kollektiver Sachverhalte sowie auf Nähe und Verbundenheit in unvermittelten sozialen Beziehungen. Zugleich ist die Beteiligung an gemeinschaftlichen ‚Ökoprojekten‘ ihrerseits unhintergehbar mit der Unterwerfung unter bestimmte, für die jeweilige Gemeinschaft konstitutive Weisen des Tuns, des Seins und des Sagens verbunden, die mitunter bis hin zu radikalen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit reichen können. In der Realität einer kontingenten, werdenden Welt sind Gemeinschaften überdies fortlaufend herausgefordert, ihre Einheitsfiktion zu aktualisieren (und ggf. zu modifizieren), Anspruch und Wirklichkeit miteinander zu vereinbaren und Auseinandersetzungen hierüber zu führen. Neben Momenten der Befreiung und Unterwerfung durch Gemeinschaft sind damit nicht zuletzt auch Fragen nach den Möglichkeiten, Notwendigkeiten und Grenzen von Dissidenz innerhalb von Gemeinschaften aufgeworfen.
Vor dem Hintergrund dieser Gemengelage fragt das Teilprojekt nach den Bildungs- und Subjektivierungsverhältnissen in und von Unternehmungen, die sich unter Anrufung des ‚Gemeinschaftlichen‘ in den Bezugsrahmen einer Krise gesellschaftlicher Naturverhältnisse stellen. Die diskursanalytisch orientierte Untersuchung zielt dabei auf eine Erschließung und Kontextualisierung des Phänomens in seiner individuellen, gesellschaftlichen und historischen Dimension.
Reflexive Herstellung einer alternativen Normalität
Reflexive Herstellung einer alternativen Normalität.
Gemeinschaften als Nischen für Einrichtung und Erprobung sozialer Praktiken
Bearbeitung: Dr. Jędrzej Sulmowski
Leitung: Prof. Dr. Thomas Alkemeyer
Gesellschaftliche Transformationen vollziehen sich nicht von allein, sondern müssen ‚gemacht‘ werden. In einer praxistheoretischen Perspektive hängen sie vor allem davon ab, ob sich die alltägliche Praxis der Menschen verändert. Jedoch entzieht sich das alltägliche Tun großenteils der Kontrolle und dem Einfluss von Einzelnen. Es ist vielmehr bedingt durch Infrastrukturen und gesellschaftliche Praktiken, die uns so geläufig sind, dass wir uns in ihnen eingerichtet haben wie in einer uns vertrauten Wohnung. Zu diesen vertrauten Umgebungen und Gewohnheiten gehören beispielsweise historisch gewachsene und ökonomisch instrumentierte Formen und Weisen des Wohnens und Essens, der Lebensmittelversorgung und -entsorgung, der Körperhygiene und des Arbeitens, der Mobilität und des Freizeitverhaltens. Die meisten Praktiken des Alltags sind so eingespielt und selbstverständlich geworden, dass sie kaum einmal befragt und angezweifelt werden. Allerdings gibt es Ausnahmen: Zumindest einige der in den Gesellschaften des globalen Nordens als normal geltenden Lebensweisen wurden in den letzten fünf Jahrzehnten mit Blick auf ihre sozialen und ökologischen Kosten zunehmend problematisiert und infrage gestellt. Kollektive und individuelle Akteure – trans- und supranationale Organisationen, staatliche Institutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen, einzelne Aktivist*innen – treten in der Öffentlichkeit seither für eine Veränderung dieser Lebensweisen ein. Dabei setzen die Einen auf Änderungen des individuellen Verhaltens etwa beim Konsum; Andere zielen hingegen auf das Einrichten von Infrastrukturen und Praktiken, die ein ressourcenschonendes, treibhausgas-reduktives, integratives und gerechtes Leben zu ermöglichen versprechen.
Das Teilprojekt leuchtet eben dieses Spannungsfeld aus: Es nimmt dabei ethnographisch gemeinschaftliche Initiativen in den Blick, die sich ihrem Selbstverständnis nach gegen ressourcenverschwenderische, emissionsintensive und/oder marktvermittelte Praktiken wenden. Sein Interesse gilt drei Fragen: Erstens wird untersucht, inwiefern diese Initiativen Nischen eines alternativen Lebens ausbilden, das für deren Bewohner*innen wiederum eine eigene (Nischen-)Normalität entfaltet. Zweitens wird erforscht, welche Bedingungen – der sozio-demographischen Gruppenzusammensetzung, der Arbeitsorganisation, der Entscheidungsfindung, der Regelung des Ein- und Austritts, der institutionellen Anbindung, der politischen oder weltanschaulichen Orientierung usw. – gegeben sein müssen, damit eine alternative Normalität gelebt werden kann. Und drittens fragen wir danach, welche Bedeutung der Rückgriff auf Semantiken und Lebensformen der Gemeinschaft dafür hat, alternative Praktiken überhaupt einrichten, stabilisieren und verbreiten zu können – und inwiefern diese Praktiken wiederum das Selbstverständnis bedingen, eine Gemeinschaft zu sein.
Mit der Beantwortung dieser Fragen trägt das Teilprojekt dazu bei, Chancen, Grenzen und Begleiterscheinungen einer Transformation durch Initiativen zu beleuchten, die sich selbst als Gemeinschaften verstehen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der Zeitdiagnose relevant, informelle ‚Politiken der Gemeinschaft‘ würden zunehmend die Erosion staatlicher Sozial- und Umweltpolitik kompensieren. Denn im Licht dieser Diagnose erscheinen kommunitaristische Bottom-Up-Initiativen nicht nur als Entwürfe einer alternativen Normalität, sondern stets auch als Mitspieler*innen einer staatlichen Top-Down-Agenda der Transformation.
Doing Gemeinschaft – doing Nachhaltigkeit (?)
Doing Gemeinschaft – doing Nachhaltigkeit (?)
Feministische Entrepreneurship-Perspektiven auf transformative Nachhaltigkeitsgemeinschaften
Bearbeitung: Juliane Friedrich
Leitung: Prof. Dr. Stephanie Birkner
Das Teilprojekt betrachtet die transformativen Elemente eines (un)doing Gemeinschaft mit besonderem Fokus auf das Zusammenspiel von Praktiken der Vergeschlechtlichung und des Unternehmerischen.
Ausgehend von der Annahme, die das soziale Gefüge Gemeinschaft als etwas versteht, das getan wird, interessiert sich dieses Teilprojekt insbesondere für die Verwobenheit nachhaltig sozialer (insbesondere in Hinblick auf Gender) und nachhaltig ökonomischer (insbesondere unternehmerischer) Praktiken.
Das Teilprojekt ist gekennzeichnet von einer Forschungshaltung, die sich an kulturanalytischen Zugängen orientiert. Ein besonderes Forschungsinteresse der empirischen Studien des Teilprojektes gilt der Gebundenheit von Inhalten und Bedeutungen von Begriffen (concepts) innerhalb des Feldes. Methodisch angedacht sind leitfadengestützte Interviews, Fokusgruppen Befragungen, qualitative und quantitative Textanalyse sowie teilnehmende Beobachtung.
Das Teilprojekt zeichnet sich damit durch eine interdisziplinär feministisch angelegte Perspektive aus, die Antwortangebote der Kultur- und Wirtschaftswissenschaften zum Forschungsgegenstand der (transformativen) Praktiken des doing Gemeinschaft im Kontext eines doing Nachhaltigkeit untersucht und hervorbringt.
Der Einzelne und die Nachhaltigkeitsgemeinschaft
Der Einzelne und die Nachhaltigkeitsgemeinschaft.
Psychologische Perspektiven auf die Bedingungen und die Effekte der Teilnahme in nachhaltigkeitsorientierten Gemeinschaften
Bearbeitung: Lena Schmeiduch
Leitung: Prof. Dr. Karsten Müller
Welche Erfahrungen machen Individuen in einer nachhaltigkeitsorientierten Gemeinschaft? Warum entscheiden sich Individuen, sich aktiv an einer nachhaltigkeitsorientierten Gemeinschaft zu beteiligen? Und wie wirken sich die Erfahrungen in und die Identifikation mit der Gemeinschaft auf ihr Engagement für Nachhaltigkeit aus?
Das Teilprojekt „Psychologische Perspektiven auf die Bedingungen und die Effekte der Teilnahme in nachhaltigkeitsorientierten Gemeinschaften“ beschäftigt sich aus einer prozessorientierten Perspektive mit dem Erleben und Verhalten von Individuen als aktive Mitglieder einer nachhaltigkeitsorientierten Gemeinschaft in verschiedenen Phasen dieser Mitgliedschaft.
Von Interesse ist hierbei das Zusammenspiel von individuellen Faktoren wie Emotionen, Kognitionen, Motiven, Einstellungen und individuellen Werte sowie situationalen Faktoren, die sich aus der Mitgliedschaft in der Gemeinschaft ergeben, wie kollektiven Werten und normativen Einflüssen. Ein besonderer Fokus kommt hierbei der Untersuchung von Affekten und Emotionen zu.
Auf der Grundlage der Analysen soll weiterhin ein tieferes Verständnis dafür entwickelt werden, wie und in welchem Umfang nachhaltigkeitsorientierte Gemeinschaften Kreativität und Gestaltungskraft auf der Suche nach einer nachhaltigen Zukunft entwickeln.
Zum Einsatz kommen hierzu vielfältige quantitative und qualitative Methoden. Dazu zählen Interviews und Befragungen, Fokusgruppen, Textanalysen, Social Media Analysen und Methoden aus dem Bereich des Experience Samplings wie Tagebuchbefragungen und Event Reconstruction Methoden.