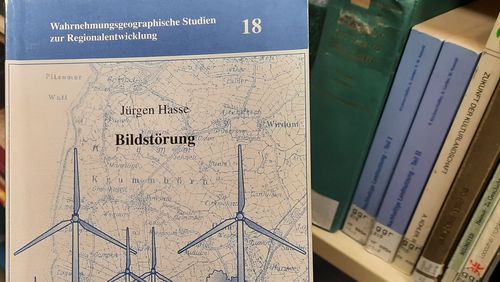Größere Niederschlagsmengen und ein steigender Meeresspiegel erhöhen das Risiko für Binnenhochwasser im Küstenraum: Das Projekt KLEVER-Risk legt dar, wie sich das westliche Ostfriesland erfolgreich an den Klimawandel anpassen kann.
Heulender Sturm, hohe Wellen, brechende Deiche – diese Bilder haben viele vor Augen, wenn es um Hochwasser an der Nordseeküste geht. Die verheerende Sturmflut von 1962 hat sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt, dank entsprechender Bilder sogar bei denjenigen, die sie selbst gar nicht miterlebt haben. Seitdem hat keine weitere Sturmflut in Deutschland eine vergleichbare Katastrophe ausgelöst. Die nach ´62 erneuerten und verbesserten Deiche hielten.
Die Gefahr von Hochwasser und Überflutungen ist dadurch jedoch nicht gebannt. Im Gegenteil. „Seitdem die Menschen vor Jahrhunderten begonnen haben, Deiche entlang der Küste zu errichten, kann das überschüssige Niederschlagswasser aus dem Binnenland nicht mehr so gut in die Nordsee abfließen. Daraus ergibt sich die Gefahr für Binnenhochwasser“, erklärt Jan Spiekermann. Der Raumplaner forscht in der Arbeitsgruppe Angewandte Geographie und Umweltplanung von Prof. Dr. Ingo Mose am Institut für Biologie und Umweltwissenschaften. In den vergangenen Jahren hat er sich ausführlich mit der Entwässerungssituation in West-Ostfriesland beschäftigt, genauer gesagt in den Gebieten der Entwässerungsverbände Emden, Norden, Aurich und Oldersum.
Forschende werfen einen Blick in die Zukunft
„Wir gehen davon aus, dass die Wassermengen, die dort abgeleitet werden müssen, in den Wintermonaten künftig um bis zu ein Viertel steigen“, sagt Spiekermann. Er ist Hauptautor des gerade fertiggestellten Berichts, der das Ende des Projekts KLEVER-Risk markiert. Auf mehr als hundert Seiten beschreiben die Autorinnen und Autoren, mit welchen Klimaveränderungen die Region in rund 50 bis 80 Jahren rechnen sollte und welche Optionen die Verantwortlichen haben, auf das steigende Hochwasserrisiko zu reagieren. Mitgewirkt haben neben Spiekermann auch seine Kollegin, die Landschaftsökologin Nadine Kramer, sowie Forschende der Jade Hochschule und Mitarbeitende der vier westostfriesischen Entwässerungsverbände, des Landkreises Aurich, der Stadt Emden und des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Gefördert wurde das Projekt für dreieinhalb Jahre mit 300.000 Euro vom Bundesumweltministerium. Es knüpfte an das vorangegangene Projekt KLEVER an, das eine ähnliche Ausrichtung hatte, aber nur das Gebiet des Entwässerungsverbands Emden betrachtete.
Meeresspiegel beeinflusst Entwässerung
Die Beteiligten der Jade Hochschule haben mit umfangreichen Modellrechnungen die Auswirkungen des Klimawandels auf den regionalen Wasserhaushalt bis zum Jahr 2100 betrachtet und anhand dieser Daten berechnet, wie viel Wasser künftig über die Schlote, Tiefs und Kanäle entwässert werden muss. Diese überwiegend künstlichen Gewässer leiten das Wasser seit Jahrhunderten in die Nordsee. Weil die Deiche dabei eine Barriere darstellen, kann das Wasser sie nur an bestimmten Stellen passieren: an Siel- und Schöpfwerken. Sielwerke schützen mit stabilen Sieltoren das Landesinnere vor dem Meerwasser. Liegt der Außenpegel, etwa bei Ebbe, jedoch niedriger als im zuführenden Gewässer, werden die Tore geöffnet und das Binnenwasser kann in die Nordsee abfließen.
Der ansteigende Meeresspiegel wird die Stunden, in denen eine Entwässerung auf diesem Weg möglich ist, teils drastisch reduzieren, haben die Forschenden berechnet. Im pessimistischsten Szenario, das einen Meeresspiegelanstieg von 110 Zentimetern bis zum Ende dieses Jahrhunderts annimmt, könnte etwa am Sielwerk Knock in Emden der Außenpegel schon in wenigen Jahrzehnten dauerhaft, also auch bei Ebbe, so hoch sein, dass so gut wie gar nicht mehr gesielt werden kann.
Infrastruktur kommt an ihre Grenzen – und in die Jahre
Die Abnahme der Sielmöglichkeiten bedeutet mehr Arbeit für die an den Sielstandorten integrierten Schöpfwerke. Sie können das Wasser mit großem Energieaufwand in die Nordsee pumpen. Je größer der zu überwindende Niveauunterschied ist, desto geringer ist jedoch die Entwässerungsleistung der Pumpen. Es reiche aber nicht aus, die Kapazitäten der nicht nur an ihre Grenzen, sondern auch in die Jahre kommenden Schöpfwerke zu erhöhen, sagt Spiekermann. Die Oldenburger Forschenden haben im engen Austausch mit den Entwässerungsverbänden vor Ort Maßnahmen entwickelt und bewertet, die das Risiko künftiger Binnenhochwasser senken sollen. Spiekermann votiert dabei für dezentrale Lösungen. So hat er etwa mit den Ortskundigen der Entwässerungsverbände potenzielle Standorte entlang der Küste ermittelt, an denen weitere Schöpfwerke gebaut werden könnten. Sie würden die bestehenden entlasten und auch helfen, den Ausfall eines anderen Werks – etwa bei Stromausfall – teilweise zu kompensieren.
„Ein weiterer Ansatz besteht darin, das Wasser möglichst lange im Binnenland zu halten und so die Schöpfwerke zu entlasten“, erklärt der Raumplaner. Zahlreiche Flächen, die aus topographischer Sicht gut geeignet wären, um große Mengen Wasser vorübergehend zu speichern, haben die Projektbeteiligten in einer Karte als sogenannte Retentionsflächen kenntlich gemacht. Prominentestes Beispiel: das Große Meer, ein See zwischen Aurich und Emden, der schon jetzt als Rückhaltefläche genutzt wird. Würden dort weitere Uferflächen im Falle eines drohenden Hochwassers gezielt überschwemmt, könnte diese Maßnahme das Entwässerungssystem um bis zu eine Million Kubikmeter Wasser entlasten. Zum Vergleich: Um diese Menge Wasser in die Nordsee abzugeben, muss das mit Abstand leistungsstärkste Schöpfwerk Knock aktuell viereinhalb Stunden bei optimalen Normaltide-Bedingungen arbeiten.
Wasserschatz statt Wasserhypothek
„Das Wasser nicht abzuleiten, sondern im Gebiet zu speichern, hat sogar Vorteile“, sagt Spiekermann. Es könne in den ebenfalls klimabedingt zunehmenden Trockenperioden genutzt werden, um angeschlossene Gewässer vor Austrocknung zu bewahren. „Vielleicht sind diese Wasserspeicher sogar perspektivisch für die Produktion von grünem Wasserstoff interessant“, sagt er mit Blick auf das sogenannte Wasserelektrolyse-Verfahren, bei dem Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird. „Jahrhundertelang sprach man in Ostfriesland von einer Wasserhypothek. Das wandelt sich: Man könnte eigentlich eher von einem Wasserschatz sprechen.“
Trotzdem: Komplett vermeiden lassen sich Hochwasser nicht. Deshalb gehören auch beispielhafte Alarmpläne, Empfehlungen für eine risikoarme Raumplanung und Tipps für die Eigenvorsorge der Bevölkerung zum umfangreichen Bericht, der laut Spiekermann das Ergebnis einer „äußerst gelungenen Zusammenarbeit“ der Forschenden mit den Fachleuten vor Ort sei. „Die Projektergebnisse verschaffen den Verantwortlichen einen großen Vorsprung bei der Anpassung an die bevorstehenden Klimaveränderungen“, ist er überzeugt. Sie haben die nötigen Informationen an der Hand, um jetzt ein sinnvolles Vorgehen zu planen.