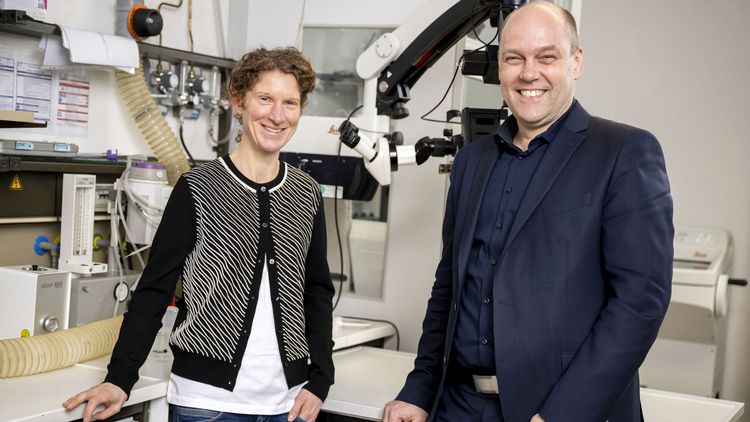Die Navigation und Orientierung von Tieren ist ein Forschungsschwerpunkt an der Universität Oldenburg. Welche Bedeutung dieses Thema für den Naturschutz, aber auch für Quantentechnologien oder autonome Fahrzeuge hat, erläutern die Biologen Henrik Mouritsen und Miriam Liedvogel im Interview.
Milliarden von Tieren begeben sich jedes Jahr auf Wanderschaft und legen dabei teils extrem weite Strecken zurück. Welche Navigationsleistungen im Tierreich finden Sie am spannendsten?
Liedvogel: Dass junge Zugvögel auf ihrem ersten Flug ihr bisher unbekanntes Ziel finden, ist wirklich erstaunlich. Die Vögel schlüpfen hier aus ihrem Ei, und dann fliegen sie nach Afrika. Die Elternvögel fliegen im Durchschnitt zwei Wochen vorher los. Man sollte annehmen, dass so ein Jungvogel eigentlich keine Ahnung davon hat, wo Afrika liegt. Aber er weiß, in welche Richtung er fliegen muss, wann er losfliegen muss und wann er am Ziel ist.
Mouritsen: Es ist erstaunlich, dass diese wenigen Anhaltspunkte reichen, um das Ziel zu finden.
Liedvogel: Und wenn sie ein Jahr später ins Winterquartier zurückkehren, finden sie nach einer Reise von Tausenden Kilometern exakt den gleichen Schlafast – auch das ist beeindruckend.
Wie wichtig ist das Phänomen der Tierwanderung für die Ökosysteme weltweit?
Mouritsen: Nur ein Beispiel, um die Dimensionen zu verdeutlichen: Ungefähr zwei Milliarden Vögel ziehen jedes Jahr allein zwischen Afrika und Europa. Das sind gigantische Biomasse-Verschiebungen, die natürlich eine enorme globale Bedeutung haben.
Liedvogel: Für die Ökosysteme sind aber auch Insekten wichtig. Ohne Insekten als Bestäuber würden große Teile der Agrarwirtschaft nicht funktionieren, und ein Großteil von diesen Insekten zieht, wie man erst seit kurzem weiß. Milliarden Schwebfliegen fliegen jedes Jahr über den Ärmelkanal, Schmetterlinge wie der Admiral überqueren die Alpen. Dass all diese Tiere zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ist entscheidend für unsere Versorgung.
Zu verstehen, wie die Tiere mit Raum und Zeit umgehen und wie sie sich bewegen, wird vor dem Hintergrund des Klimawandels noch wichtiger.
Welche Herausforderungen bringt der Klimawandel für wandernde Tierarten?
Mouritsen: Durch die Erwärmung verlagern sich Lebensräume. Deswegen müssen sich die Tiere mehr bewegen, ganz einfach, weil sie den Lebensräumen folgen müssen. Das bedeutet: Zu verstehen, wie die Tiere mit Raum und Zeit umgehen und wie sie sich bewegen, wird vor dem Hintergrund des Klimawandels noch wichtiger.
Liedvogel: Ein besonderes Problem für wandernde Tierarten ist, dass die Veränderungen entlang der Zugroute nicht miteinander gekoppelt sind. Die Langstreckenzieher sind am wenigsten flexibel. Wenn sie im Herbst im Brutgebiet nicht rechtzeitig losfliegen, finden sie vielleicht unterwegs kein Futter und überleben möglicherweise den Zug nicht.
Mouritsen: Tatsächlich gehen die Populationen der Vögel, die nach Afrika ziehen, am stärksten zurück. Für sie ist nicht nur der Klimawandel ein Problem, sondern auch die fortschreitende Wüstenbildung in der Sahelzone südlich der Sahara, die auch mit dem starken Bevölkerungswachstum dort zusammenhängt. Schon jetzt müssen die Vögel fast ihr Gewicht verdoppeln, um genug Energie für den Flug über die Sahara und das Mittelmeer zu haben. Beim Flug zehren sie teilweise ihre inneren Organe auf. Wenn die Wüste noch breiter wird, ist es für sie wahrscheinlich irgendwann physiologisch nicht mehr möglich, diese enorme Barriere zu überwinden.
Wie kann man wandernden Tieren dabei helfen, sich an die Veränderungen anzupassen?
Mouritsen: Das ist ein Thema, das wir demnächst erforschen möchten. Dazu müssen wir zunächst sehr genau verstehen, wie Tiere zu einem bestimmten Ort navigieren und welche Hinweise sie dabei nutzen. So können wir Schlussfolgerungen darüber ziehen, welche Störeinflüsse es gibt oder wie man sie beispielsweise dazu bringen könnte, sich in einem anderen Gebiet anzusiedeln oder ihre Zugroute zu ändern.
Lässt sich dieses Wissen praktisch einsetzen?
Liedvogel: Es gibt bereits zahlreiche Projekte, in denen Naturschützer versuchen, das lokale Aussterben von Arten aufzuhalten oder gar rückgängig zu machen, also so genanntes „Rewilding“ zu betreiben. Dabei werden Teile von gesunden Populationen oder Tiere, die in Gefangenschaft aufgezogen wurden, versetzt und an einem passenden Ort wieder angesiedelt. Aber nur weniger als die Hälfte dieser Umsiedlungsprojekte funktionieren, das war ein Ergebnis der Biodiversitätskonferenz 2023 in Montreal. Der Grund ist oft: Die Tiere bleiben nicht da, wo man sie ausgesetzt hat. Sie spüren, dass dies nicht ihre „Heimat“ ist. Wir müssen also verstehen, wie Tiere „Heimat“ definieren, und wir müssen ihre Navigationsmechanismen und ihre Sinneswahrnehmung verstehen. Eine Idee zur Lösung des Problems ist, dass man etwa Jungvögel von bestimmten Informationen zu ihrem Standort isoliert, bis man sie zu der Stelle gebracht hat, an der man sie auswildern möchte, damit sie diesen Ort als Heimat akzeptieren. Aber wir wissen noch zu wenig.
Eine wichtige Rolle bei der Navigation von Zugvögeln spielt der Magnetsinn, dessen Funktionsweise hier in Oldenburg auch gemeinsam mit Forschenden aus Oxford genau erforscht wird, unter anderem in Ihrem Sonderforschungsbereich „Magnetrezeption und Navigation in Vertebraten“. Wie funktioniert diese Sinneswahrnehmung?
Mouritsen: Wir wissen, dass der Magnetsinn lichtabhängig ist. Wir wissen, dass die Vögel den Winkel der Feldlinien zur Erdoberfläche messen, die so genannte Inklination. Wir wissen, dass der magnetische Kompass im Auge sitzt und dass die Information in einem Teil des Gehirns verarbeitet wird, der für visuelle Informationen zuständig ist. Und wir haben eine Hypothese zum Mechanismus: Es gibt ein Protein im Auge, Chryptochrom 4, das Magnetfelder über einen quantenmechanischen Mechanismus wahrnimmt. Das Molekül, das wir in Verdacht haben, können wir mit Hilfe von Bakterienkulturen selbst herstellen und untersuchen. Mit unseren Partnern in Oxford konnten wir zeigen, dass das Cryptochrom 4 von Rotkehlchen magnetisch sensitiv ist. Das ist zwar noch kein Beweis, aber ein deutliches Indiz.
Man hat lange angenommen, dass die Energie des Erdmagnetfeldes bei weitem nicht ausreicht, um Biomoleküle zu beeinflussen.
Mouritsen: Ja, es hieß, dass das Erdmagnetfeld um den Faktor 10 Millionen zu schwach ist, um beispielsweise Bindungen innerhalb von Proteinen zu spalten. Inzwischen haben wir nachgewiesen, dass Felder, die etwa hundertmal so stark sind wie das Erdmagnetfeld – also hunderttausendmal schwächer als der ursprünglich angenommene Grenzwert – auf jeden Fall eine Wirkung auf das von uns untersuchte magnetsensitives Protein haben. Und wir glauben, dass diese Empfindlichkeit in der natürlichen Umgebung, also einer Sinneszelle im Auge, noch weiter zunimmt. Um das zu simulieren, haben wir künstlich mutierte Proteine hergestellt, die wir nun testen.
Liedvogel: Interessanterweise haben meine Kollegin Corinna Langebrake und ich in einer unabhängigen genetischen Studie festgestellt, dass sich im Zuge der Evolution der Vögel genau die gleichen Bereiche im Protein verändert haben, die ihr jetzt untersucht – wahrscheinlich wurde über Millionen von Jahren die Effizienz des Proteins für die Magnetwahrnehmung optimiert.
Dass quantenmechanische Effekte in der Biologie eine Rolle spielen könnten, galt vor ein paar Jahren ebenfalls noch als unwahrscheinlich.
Mouritsen: Ja, weil Quantenphänomene meist nur bei sehr niedrigen Temperaturen oder auf extrem kleinen Längenskalen sichtbar werden. Die Lehrmeinung war daher, dass Quanteneffekte viel zu fragil sind, um in der warmen, feuchten und chaotischen Umgebung einer Zelle bedeutsam zu sein. Aber das stimmt offenbar nicht, und das ist aus meiner Sicht das Spannendste überhaupt. Daher hat diese Forschung eine grundlegende Bedeutung, die weit über Vögel hinausgeht. Wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass sich Leute, die Quantencomputer bauen, dafür interessieren könnten, wie Zugvögel ihren Weg nach Afrika finden, hätte ich ihn für verrückt erklärt!
Wenn man das Prinzip aus der Biologie übertragen könnte, dann könnten sich hieraus Ansätze für Quantencomputer oder Quantensensoren ergeben, die viel einfacher anzuwenden wären als heutige Technologien.
Was hat denn die Magnetwahrnehmung der Vögel mit Quantencomputern zu tun?
Mouritsen: In Quantencomputern könnten sehr ähnliche Mechanismen zum Speichern von Informationen genutzt werden wie sie Vögel unserer Hypothese nach bei der Magnetwahrnehmung verwenden. Insbesondere geht es dabei um sogenannte gekoppelte Elektronenspins. Der Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft von Elektronen. Bei der Magnetwahrnehmung sind zwei Elektronen vermutlich für Bruchteile einer Sekunde über ihren Spin miteinander gekoppelt. Man kann sie sich als Mini-Magneten vorstellen, und abhängig von der Richtung des Spins haben Magnetfelder wie das Erdmagnetfeld einen unterschiedlichen Einfluss auf sie. In einem Quantencomputer könnten Elektronenspins die Basis für sogenannte Qubits bilden, also die elementaren Bausteine solcher Computer zum Speichern von Informationen. Allerdings arbeiten die meisten aktuellen Quantencomputerarchitekturen bei Temperaturen knapp über dem absoluten Nullpunkt. Vögel nutzen den Mechanismus dagegen bei plus 40 Grad Celsius! Wenn man das Prinzip aus der Biologie übertragen könnte, dann könnten sich hieraus Ansätze für Quantencomputer oder Quantensensoren ergeben, die viel einfacher anzuwenden wären als heutige Technologien. Natürlich nicht morgen und nicht übermorgen, aber vielleicht in zehn oder 20 Jahren. In unserer künftigen Forschung wollen wir daher quantenmechanische Effekte bei Raumtemperatur besser verstehen.
Könnten die Navigationssysteme der Tiere auch in anderer Hinsicht ein Vorbild für neue Technologien sein?
Liedvogel: Auch das wollen wir ausprobieren. Wir glauben, dass autonome technische Systeme besser werden können, wenn sie sich ähnlich wie Tiere bei der Navigation auf eine große Zahl einfach aufgebauter Sensoren verlassen und nicht nur auf sehr wenige präzise, aber dafür sehr komplizierte Sensoren.
Mouritsen: Navigierende Tiere nutzen ihre Ressourcen sehr clever: Sie verfügen über Millionen oder sogar Milliarden relativ ungenauer Sensoren – etwa die Cryptochrom-Proteine, um die Richtung des Magnetfelds zu bestimmen. Jedoch ist der Durchschnittswert aus all diesen Sensoren sehr genau. Dazu kommt, dass Tiere über einen eher kleinen „Computer“ verfügen. Weil ihr Gehirn aber gute Informationen von den Sinnesorganen bekommt, können sie auf relativ simple Entscheidungsalgorithmen zurückgreifen. Sie sind daher technischen Systemen bei schwierigen Entscheidungen und bei der Energieeffizienz überlegen. Wenn man die Lösungen aus der Biologie mit den technischen, KI-basierten Lösungen kombiniert, hat man das Beste aus beiden Welten.
Interview: Ute Kehse und Volker Sandmann