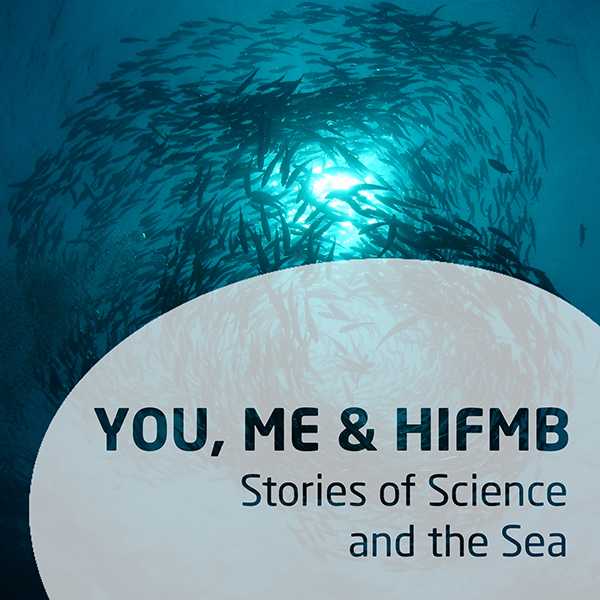Im Mai erscheint die 50. Folge des Podcasts „Hirn gehört – Oldenburger Wissensschnack“. Wir haben mit dem Moderationsduo gesprochen und geben einen Überblick über mehr Podcasts aus dem Uni-Kosmos.
Bei „Hirn gehört“ trefft ihr jeden Monat eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler und fragt ihn unter anderem nach einem persönlichen beruflichen Fail. Seid ihr beim Podcast auch schon mal gescheitert?
Brüggen: Zum Glück nicht, aber gerade vergangene Woche hatten wir heftige Probleme. Wir treffen uns mit unseren Gesprächsgästen immer auf einer speziellen Online-Plattform. Zuerst hat der Zugang zur Plattform technisch nicht wie gewohnt funktioniert, dann war plötzlich die Tonspur des Gastes verschwunden. Zum Glück konnten wir das Problem am nächsten Tag lösen und so die Folge retten.
Die erste Folge erschien 2021, als die Veranstaltungsreihe „Hirn vom Hahn“ pandemiebedingt ausfiel. „Hirn vom Hahn“ findet längst wieder statt, aber es gibt den Podcast weiterhin. Warum?
Scherer: Wir waren als ganzes Team schnell gut eingespielt, so dass die Arbeitslast für jeden einzelnen überschaubar ist. Die Mitglieder des Oldenburger Netzwerks für Wissenschaftskommunikation, in dessen Auftrag wir den Podcast machen, kümmern sich um die Akquise der Gäste. Bianca und ich bereiten die Folgen inhaltlich vor und führen die Interviews und unsere FWJ-lerin Kim Kea Meinen schneidet das Material.
Brüggen: Ich sage immer: Wir wurden bisher einfach nicht abgesetzt. (lacht) Außerdem macht es uns total viel Spaß. Man lernt jedes Mal einen anderen Menschen kennen und vor allen Dingen den Menschen hinter der Forschung. Es ist erstaunlich, von wie vielen Zufällen Karrierewege abhängen und wie viele Fails auch heute sehr erfolgreiche Personen hinter sich haben. Im Nachhinein kann man einen Lebenslauf immer stringent erklären, aber wir erzählen das Leben von vorne – und kriegen alle Schlenker mit.
Scherer: Gleichzeitig tauchen wir jedes Mal in ein neues Forschungsthema ab – und beim nächsten Mal in das nächste. Das liebe ich! Folge für Folge ist dabei ein sehr vielfältiges Gesamtwerk entstanden. Ich glaube, es gelingt uns, eine schöne und sichere Gesprächssituation zu schaffen, in der Forschende sich leicht öffnen können, und vermitteln damit eine ganz andere Facette als „Hirn vom Hahn“.
In den aktuell fast 50 Folgen erfahren Hörer*innen auch viele private Details von euren Interviewgästen. Welche Geschichten sind euch besonders in Erinnerung geblieben – und warum?
Brüggen: Wenn ich eine Folge empfehle, ist es immer die Folge 13 mit dem Viszeralchirurgen Prof. Dr. Dirk Weyhe. Er erzählt, wie er während seiner Ausbildung als Notarzt einen Einsatz bei einem älteren Ehepaar hatte und durch eine Verkettung unglücklicher Umstände Teile des Wohnzimmers zerlegt hat. Eine wirklich lustige Geschichte, die einmal mehr zeigt, dass bei jedem mal etwas schief geht.
Scherer: Mich hat auch Dr. Alexandra Pehlken beeindruckt, die in Folge 3 zu Gast war. Sie hat auf sehr persönliche Weise erzählt, wie sie als promovierte Ingenieurin aus Kanada zurück nach Deutschland gekommen ist, nach einem Jahr in Elternzeit keinen Job gefunden hat und erstmals arbeitslos war. Heute forscht sie erfolgreich am OFFIS. Sehr persönlich war auch die Geschichte der Kinderheilkundlerin Prof. Dr. Anne Hilgendorff. Ihre Doktorarbeit hat sie über herztransplantierte Menschen geschrieben und damals noch nicht geahnt, dass sie Jahre später selbst eine Herztransplantation bekommt.
An der Universität entstehen immer mehr Podcasts. Was ratet ihr Anfänger*innen?
Brüggen: Sie sollten darauf achten, dass Zuhörerinnen und Zuhörer einen Bezug zu sich selbst herstellen können. Bei unserem Podcast liegt der Fokus auf dem Mutmachen, deshalb ist die Frage nach dem Fail in meinen Augen auch so wichtig.
Scherer: Wenn man ein Konzept hat, ist es wichtig, dabei zu bleiben. Beständigkeit ist wie ein Anker im Kopf und Hörerinnen und Hörer freuen sich auf die etablierten Strukturen. Technisch gesehen ist besonders eine gute Soundqualität wichtig. Die Zeit, in der man Podcasts schlechten Sound verziehen hat, ist vorbei.
Welche Zukunftspläne gibt es?
Scherer: Ich wünsche mir manchmal mehr Interaktion mit den Zuhörenden und denke über mögliche Beteiligungskonzepte nach.
Brüggen: Und ansonsten machen wir weiter, solange man uns lässt. Spannende Gesprächspartnerinnen und -partner gibt es genug. Die zwölf Slots für 2025 waren bereits Anfang des Jahres vergeben.
Interview: Sonja Niemann