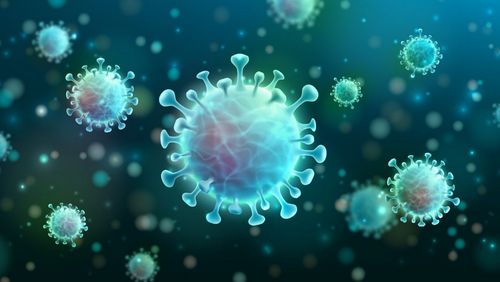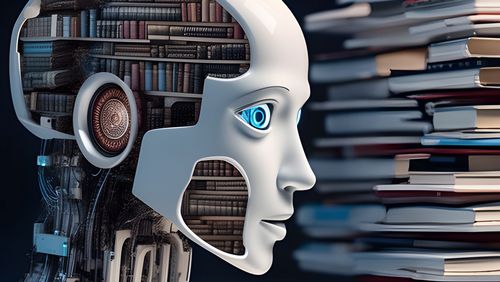21. März 2025 040/25
Forschung
Wie die Corona-Pandemie das Vertrauen in Regierung, Polizei und Medien verändert hat
Studie zum politischen Vertrauen in Krisenzeiten zeigt eine in Teilen anhaltende Vertrauenskrise
Oldenburg. Fünf Jahre ist es her, dass die damalige Bundesregierung am 22. März 2020 den ersten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängte. Was als zweiwöchige Maßnahme begann, entwickelte sich zu einer langanhaltenden Krise mit Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und geschlossenen Schulen und Kitas. In den drei folgenden Pandemiejahren veränderte sich auch das politische Vertrauen der Menschen in Deutschland erheblich. Eine aktuelle Studie der Universität Oldenburg und des Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (LIfBi) zeigt: Während das Vertrauen in politische Institutionen im Verlauf des ersten Krisenjahres besonders stark anstieg, ist es in den späteren Pandemiephasen wieder gesunken – mit langfristigen Folgen. Auch gegenüber Polizei und Printmedien sank das Vertrauen und erreichte später nicht wieder das vorpandemische Niveau.
Die Studie, die auf Daten des Nationalen Bildungspanels (NEPS) basiert, zeigt, dass Deutschland im ersten Pandemiejahr einen sogenannten „rally-around-the-flag-Effekt“ (im Deutschen auch als „Stunde der Exekutive“ bezeichnet) erlebte: Das durchschnittliche politische Vertrauen stieg zu Beginn der Krise auf einer Skala von 1 (sehr wenig Vertrauen) bis 4 (sehr viel Vertrauen) von 2,37 auf 2,55 an, bevor es im zweiten Pandemiejahr wieder zurückging. Zu Beginn der Pandemie erhielten dabei vor allem staatliche Kerninstitutionen wie Bundesregierung und Bundestag einen Vertrauensbonus.
„Krisenzeiten führen oft kurzfristig zu einer Stärkung des politischen Vertrauens in den Staat. Doch je länger eine Krise andauert und je größer die sozialen und wirtschaftlichen Belastungen werden, desto eher kehrt sich dieser Effekt um. Das sieht man deutlich daran, dass das Vertrauen in Bundesregierung und Bundestag im zweiten Pandemiejahr gesunken ist“, erklärt Projektleiterin Prof. Dr. Gundula Zoch, Hochschullehrerin für die Soziologie sozialer Ungleichheiten an der Universität Oldenburg.
Polizei verliert Zuspruch
Die Polizei, die während der Pandemie eine zentrale Rolle bei der Durchsetzung von Infektionsschutzmaßnahmen spielte, verlor im Verlauf der Krise nachhaltig an Vertrauen. Während sie vor der Pandemie als eine der vertrauenswürdigsten Institutionen überhaupt galt, sank ihr Vertrauenswert im zweiten Pandemiejahr stark und erreichte auch später nicht mehr das Vorkrisenniveau. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Teile der Bevölkerung die polizeiliche Umsetzung von Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Versammlungsverboten und Ausgangssperren zunehmend kritisch wahrnahmen.
Vertrauenskrise auch gegenüber Medien
Aber nicht nur staatliche Institutionen waren betroffen. Die Studie zeigt für das zweite Jahr der Pandemie einen deutlichen Vertrauensverlust der Befragten auch gegenüber verschiedenen Medienarten: Vor allem das – ohnehin geringste – Vertrauen in die sozialen Medien ging stark zurück. Auch Fernsehen und Zeitungen wurde etwas weniger vertraut. Erst im Jahr 2023 stieg das durchschnittliche Medienvertrauen wieder an. Dabei gab es jedoch große Unterschiede zwischen den Medienarten: So verzeichneten die sozialen Medien einen hohen Vertrauenszuwachs und genossen am Ende der Krise sogar mehr Vertrauen als zu Beginn. Dagegen erreichte das Vertrauen in die Printmedien nicht wieder das Vorkrisenniveau.
„Unsere Analyse zeigt, dass das politische Vertrauen während der Pandemie stark schwankte. Besonders kritisch ist, dass sich das Vertrauen in Fernsehen und soziale Medien zwar erholte, das Vertrauen in die etablierten Printmedien jedoch nachhaltig geschwächt blieb“, so Dr. Steffen Wamsler vom LIfBi.
Die langfristigen Gefahren von verlorenem Vertrauen
„Die Studie macht deutlich, dass politisches Vertrauen gerade in Krisenzeiten fragil ist – und dass verlorenes Vertrauen Zeit braucht, um sich nach einer Krise wiederaufzubauen“, fasst Projektleiterin Gundula Zoch die Ergebnisse zusammen. Ein langfristig stabiles Vertrauen in politische Institutionen, aber auch in Medien, ist essenziell für die Funktionsfähigkeit einer Demokratie. Erodiert dieses, kann das Funktionieren der Regierung massiv beeinträchtigt werden, etwa wenn die Legitimität ihrer Entscheidungen oder die Wahl selbst bezweifelt werden. Ein Mangel an politischem Vertrauen ist zudem ein wesentlicher Auslöser für die Verbreitung von Verschwörungserzählungen, die das Zusammenleben in der Gesellschaft ebenso wie das politische System beschädigen können.
Die Studie und ihre Daten
Die Studie basiert auf Daten von 7.008 Befragten, die im Rahmen der Startkohorte Erwachsene des Nationalen Bildungspanels (NEPS) zwischen 2017 und 2023 fünfmal zu ihrem politischen Vertrauen befragt wurden, sowie auf statistischen Daten aus 353 Landkreisen in Deutschland. Die Analyse berücksichtigt sowohl individuelle als auch regionale Faktoren wie Inzidenzraten, Maßnahmen zum Infektionsschutz, Veränderungen im Arbeits- und Familienleben oder pandemiebedingte Stressfaktoren. Die Ergebnisse wurden mittels längsschnittlicher Regressionsmodelle berechnet, um individuelle Veränderungen im politischen Vertrauen und Einflussfaktoren auf dieses über den gesamten Krisenverlauf hinweg nachzuzeichnen.
Entstanden ist die Studie im Rahmen des Projekts „Politische Einstellungen und politische Partizipation in Folge der Covid-19-Pandemie“ (PEPP-COV), das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Es untersucht den Wandel politischer Einstellungen und die damit verbundene Entwicklung von gesellschaftlicher und politischer Partizipation in Folge der Corona-Pandemie.
Originalpublikation: Steffen Wamsler / Gundula Zoch: „Auf und Ab: Die wechselhafte Entwicklung politischen Vertrauens in andauernden Krisenzeiten“, LIfBi Forschung Kompakt (06/2025), doi.org/10.5157/LIfBi:Bericht:06:PEPP-COV:1.0
Weblinks