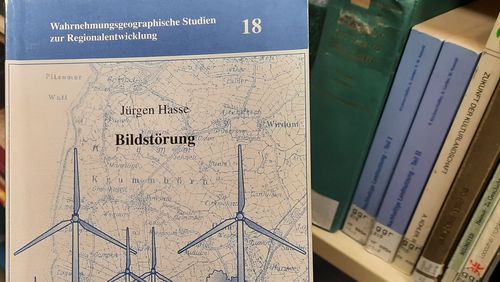Forschende der Universitäten Cambridge und Oldenburg haben herausgefunden, dass bestimmte in Seen lebende Bakterien lieber Kunststoffe vertilgen als natürliche Nahrung. Sie können somit Plastikmüll in Gewässern auf natürlichem Weg zersetzen.
Die Studie ergab, dass einige natürlich vorkommende Bakterien die im Wasser gelösten Überreste von Plastiktüten schneller und effizienter verwerten als natürliche Materialien wie Blätter und Zweige. Die Bakterien nutzen aus Plastik stammende Kohlenstoffverbindungen als Nahrung, so die Forschenden in der Zeitschrift „Nature Communications“. Demnach könnte die Anreicherung von Gewässern mit bestimmten Bakterienarten dazu beitragen, die Umwelt auf natürliche Weise von Plastikverschmutzung befreien.
Der Effekt ist der Studie zufolge stark ausgeprägt: Erhöhte sich der Kohlenstoffgehalt des Wassers durch Plastikpartikel um nur vier Prozent, verdoppelte sich die Wachstumsrate der Bakterien. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Bakterien nicht nur das Plastik abbauen, sondern anschließend auch besser in der Lage sind, andere natürliche Kohlenstoffverbindungen zu verwerten.
„Es ist fast so, als ob die Plastikverschmutzung den Appetit der Bakterien anregt. Die Bakterien nutzen zuerst das Plastik als Nahrung, weil es leicht abbaubar ist, und sind dann eher in der Lage, die weniger leicht zugängliche Nahrung – die natürliche organische Substanz im See – abzubauen“, so Dr. Andrew Tanentzap vom Department für Pflanzenwissenschaften an der Universität Cambridge, Hauptautor der Studie. „Das deutet darauf hin, dass die Plastikverschmutzung das gesamte Nahrungsnetz in den Seen stimuliert, denn mehr Bakterien bedeuten mehr Nahrung für die größeren Organismen wie Enten und Fische.“ Die Forschenden betonen, dass es dennoch wichtig sei, den Kampf gegen die Plastikverschmutzung fortzusetzen – zumal einige der aus Kunststoffen freigesetzten Verbindungen giftig sind, insbesondere in hohen Konzentrationen.
Klebstoffe und Weichmacher als Quelle der Verschmutzung
Die Analyse dieser Abbauprodukte fand unter Leitung des Oldenburger Meereschemikers Prof. Dr. Thorsten Dittmar statt. Die Untersuchungen ergaben, dass die Substanzen sich chemisch von Kohlenstoffverbindungen unterscheiden, die beim Abbau natürlichen organischen Materials entstehen, etwa von Blättern und Zweigen. Es zeigte sich, dass Zusatzstoffe wie Klebstoffe und Weichmacher die wichtigste Quelle der Verschmutzung waren.
„Wir waren überrascht, um welch komplexe Mischung es sich bei den Plastiktüten aus Polyethylen handelt“, so Dittmar. „Im Wasser fanden sich mehr als 800 gelöste Komponenten.“ Die Analyse des Gemischs fand in den Labors des Instituts für Chemie und Biologie des Meeres (ICBM) der Universität Oldenburg statt, wo Dittmar eine Brücken-Forschungsgruppe mit dem Bremer Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie leitet. Zum Einsatz kam ein extrem leistungsfähiges Messgerät der Gruppe, das ultrahochauflösende Massenspektrometer. „Diese Maschine ist in dieser Form weltweit einmalig in der Meeresforschung“, so Dittmar. „Mit ihrer Hilfe konnten wir lösliche Spuren von Plastik in Gewässern in höchster Empfindlichkeit aufspüren.“
Eine von den Forschenden aus Cambridge im vergangenen Jahr veröffentlichte Studie hatte ergeben, dass europäische Seen potenzielle Hotspots der Mikroplastik-Verschmutzung sind. Die neuen Ergebnisse könnten dazu beitragen, künftig Schwerpunkte bei der Überwachung der Gewässer zu setzen. So ergab die Studie, dass Seen mit mehr Bakterienarten besser in der Lage waren, die Plastikverschmutzung abzubauen. Ein weiteres Ergebnis: In jenen Seen, die weniger natürliche Kohlenstoffverbindungen enthielten, entfernten die Bakterien die Plastikverschmutzung besser. Dies führen die Forschenden darauf zurück, dass die Bakterien weniger andere Nahrungsquellen im Seewasser fanden. Sie folgern, dass in Seen, die stark mit Kunststoffen verschmutzt sind, eine geringe bakterielle Vielfalt und eine große Zahl natürlicher organischer Verbindungen aufweisen, besonders anfällig für Schäden sein könnten.
„Leider werden Kunststoffe unsere Umwelt noch auf Jahrzehnte hinaus verschmutzen. Unsere Studie trägt zumindest dazu bei, Mikroben zu identifizieren, die dabei helfen könnten, Plastikmüll abzubauen und die Umweltverschmutzung besser in den Griff zu bekommen“, so Prof. Dr. David Aldridge vom Department für Zoologie der Universität Cambridge, der ebenfalls an der Studie beteiligt war.
Proben aus 29 skandinavischen Seen
Für die Studie nahmen die Forschenden zwischen August und September 2019 Proben in insgesamt 29 Seen in unterschiedlichen Teilen Skandinaviens. Um verschiedene Umweltbedingungen vergleichen zu können, wählten sie Seen, die sich in Breitengrad, Tiefe, Fläche, durchschnittlicher Oberflächentemperatur und Vielfalt der gelösten kohlenstoffbasierten Moleküle unterschieden.
Um die Umweltverschmutzung durch Kunststoffe zu simulieren, zerschnitten die Forschenden Plastiktüten von vier großen britischen Einkaufsketten. Sie schüttelten diese Schnipsel in destilliertem Wasser, um einzelne Kohlenstoffverbindungen freizusetzen.
Anschließend füllten sie an jedem See Glasflaschen mit Seewasser. Die Hälfte dieser Proben versetzten sie mit einer kleinen Menge des zuvor erzeugten „Plastikwassers“, zu den anderen Flaschen fügten sie die gleiche Menge destilliertes Wasser zu. Nach 72 Stunden im Dunkeln ermittelten sie die bakterielle Aktivität in jeder der Flaschen.
Dabei untersuchten sie einerseits das Bakterienwachstum anhand der Massenzunahme und andererseits die Effizienz des Bakterienwachstums anhand der freigesetzten Kohlendioxidmenge. In den Proben mit Kunststoffverschmutzung wuchsen die Bakterien sehr effizient. Sie nahmen etwa 50 Prozent des zugesetzten Kohlenstoffs innerhalb von 72 Stunden auf.
„Unsere Studie zeigt, dass Plastiktüten, die in Seen und Flüsse gelangen, drastische und unerwartete Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben können. Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse die Menschen dazu ermutigen, noch mehr aufzupassen, wie sie ihren Plastikmüll entsorgen“, so Eleanor Sheridan vom Fachbereich Pflanzenwissenschaften der Universität Cambridge, die als Doktorandin Erstautorin der Studie war. Die Forschung wurde vom Europäischen Forschungsrat finanziert.