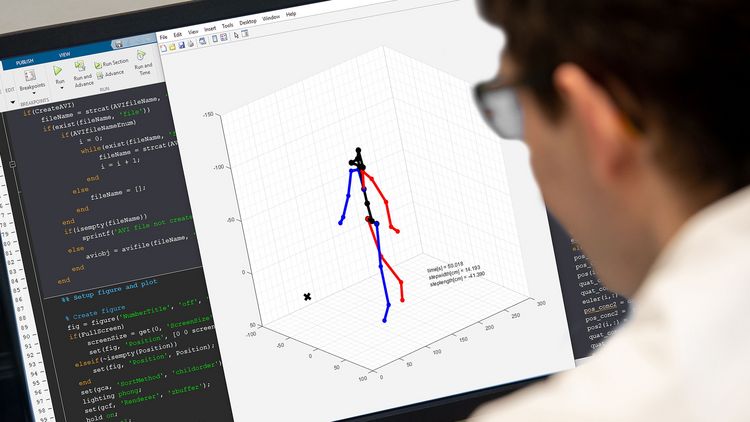Es ist ein Thema, das jeden betrifft: das Altern und das Alter. Geriaterin Tania Zieschang und Medizinethiker Mark Schweda erforschen es aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ein Gespräch über Roboter in der Pflege, den Pandemieschutz Älterer – und über das, was bleibt.
Frau Zieschang, wie beinahe sämtliche Organismen altern wir alle. Ab wann denn eigentlich?
Tania Zieschang: In mancher Hinsicht beginnt das schon ab der Geburt. Spätestens mit 20 sieht man Veränderungen sowohl auf zellulärer als auch auf molekularer Ebene. Die Telomere – also die Chromosomen-Enden – verkürzen sich, Zellen verändern sich, bestimmte Stoffwechselprodukte fallen an. Wir haben also durchaus bei ganz jungen Menschen schon Alterserscheinungen. Das fängt früh an.
Mit dem Alter und dem Altern beschäftigen sich viele Disziplinen – von der Biologie und Psychologie bis hin zu den Sozialwissenschaften. Aus Ihrer Sicht – also aus der Sicht einer Geriaterin und eines Ethikers – was ist das, das Alter?
Zieschang: Zunächst einmal muss man sich verdeutlichen, wie heterogen die Gruppe der Älteren ist – viel stärker als jüngere Altersgruppen. Es gibt 80-Jährige, die noch Marathon laufen oder eine neue Sprache lernen, und auf der anderen Seite 70-Jährige, die vollständig pflegebedürftig sind. Für mich als Geriaterin stehen diejenigen im Mittelpunkt, die einen erhöhten Bedarf an Unterstützung haben, deren Selbstständigkeit gefährdet oder bereits eingeschränkt ist. Das sind insbesondere die über 80-Jährigen, aber auch multimorbide – also mehrfach erkrankte – „jüngere Alte“ über 70.
Also ist der Unterstützungsbedarf Ihr Hauptkriterium?
Zieschang: Genau. Natürlich kann jeder von uns durch einen Unfall oder eine schwere Erkrankung plötzlich in der Selbstständigkeit gefährdet sein. Aber ich spreche von Patienten, bei denen wir genau wissen, dass schon ein banaler Infekt oder eine kleinere Störung zu einer Abwärtsspirale führen kann. Die Reserven – auch bei einem 80-jährigen Marathonläufer – sind einfach nicht mehr so wie im jüngeren Alter. Und auf diese vulnerable, sehr heterogene Gruppe fokussieren wir uns.
Mark Schweda: Das Altern ist in der Tat ein facettenreiches und vieldimensionales Phänomen. Zunächst einmal ist es ein kalendarisches Faktum: Wir haben mit der Zeit einfach mehr Jahre auf dem Buckel, und das verändert – im Wortsinn – auch unseren Standpunkt im Leben. Neben dem beschriebenen funktionellen Aspekt ist Altern daher natürlich auch ein psychisch-mentaler Vorgang: Da passiert etwas mit uns, unsere Sicht auf die Dinge verändert sich. Und schließlich ist Altern ein soziales Phänomen. Ob wir als alt gelten oder nicht, entscheiden nicht zuletzt die anderen. In modernen Industriegesellschaften ist die Schwelle zum Alter der Eintritt in den Ruhestand. Früher bekam man vielleicht eine goldene Uhr geschenkt und wurde nach Hause geschickt, um sich in den Lehnstuhl zu setzen und zu warten. Und worauf? Auf den Tod! Das war lange die vorgesehene Altersrolle.
Eine sozial definierte Rolle.
Schweda: Da sind kulturelle Vorstellungen wichtig, Bilder, die wir im Kopf haben. Oft sind diese sehr negativ, haben mit Defiziten zu tun. Daran ist die Medizin nicht ganz unschuldig. Denn wenn man mit medizinischer Brille auf den alternden Menschen schaut, sieht man in erster Linie physiologische Abbauprozesse, schwindende Reserven und Leistungsfähigkeit. Dabei eröffnen sich aus anderen Blickwinkeln viel positivere Sichtweisen auf das Altern. In der philosophischen Überlieferung wird Altern etwa vielfach mit Weisheit in Verbindung gebracht, einer Lebenserfahrung, die mir einen Überblick und eine bessere Einsicht in die Dinge vermittelt. Dass wir das Altern heute überwiegend aus einer medizinischen Perspektive wahrnehmen, ist einerseits wichtig, weil man inzwischen viel machen kann bei altersassoziierten Beeinträchtigungen und Erkrankungen. Andererseits geht es mit der Gefahr einher, dass man Alterserscheinungen zunehmend nur noch als Krankheiten wahrnimmt.
Zieschang: Es gibt eine gewisse Bewegung in der Geriatrie und der Medizin insgesamt, von diesem rein pathologisch orientierten Defizitmodell wegzukommen und stattdessen den Prozess der Entstehung und Erhaltung von Gesundheit in den Fokus zu setzen, die sogenannte Salutogenese. Ein Denkmodell, das ich meinen Patientinnen und Patienten gern anbiete: Dass es doch eigentlich ein Wunder ist, dass unser Organismus sich bei allen Störfaktoren über Jahrzehnte erfolgreich reguliert. Hinter dieser sogenannten Homöostase steckt ein riesiger Aufwand, den wir kaum wahrnehmen.
Sie richten also den Blick bewusst auf die Ressourcen.
Zieschang: Diesen Ansatz haben wir in unserer geriatrischen Arbeit verankert. In Teambesprechungen beschreiben wir bewusst, was ein Patient kann und was die Potenziale sind. Dabei schauen wir auch: Wie kann das Umfeld als soziale Ressource den Patienten in Zukunft stützen? Das verändert schon viel in den Köpfen. Aber ich gebe zu, dass auch wir Geriater leicht zurückfallen in dieses Defizitdenken. Die Medizin geht von Gesundheit als Normalzustand aus und gesellschaftlich gehen wir aus vom perfekten Gesicht mit glatter Haut, in dem jede Falte als Störung empfunden wird. Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, deren Blick aufs Alter von negativen Stereotypen geprägt ist, einen verkleinerten Hippocampus haben. Das ist die Hirnregion, die sich bei einer Alzheimer-Demenz als Erstes verändert. Und in einer Longitudinal-Beobachtung zeigte sich, dass Menschen mit negativer Einstellung zum Alter ein deutlich höheres Risiko haben, an einer Demenz zu erkranken. Es scheint also auch an uns selbst zu liegen. Eine Hypothese: Wenn wir als Gesellschaft auf die Stärken des Alters fokussierten, ließe sich möglicherweise der kognitive Abbau im Alter erheblich reduzieren.
„Wenn wir aus Stahlbeton wären, bräuchten wir keine Moral.“ (Mark Schweda)
Wie sehen Sie das, Herr Schweda? In einem Forschungsprojekt haben Sie das „erfolgreiche Altern“ aus normativer Sicht durchleuchtet …
Schweda: Den Diskurs über positive Leitbilder des Alters führen wir bestimmt seit fünf oder sechs Jahrzehnten. „Successful Aging“ – also erfolgreiches, aktives, gesundes und produktives Altern: Das sind die Schlagworte, die in der gerontologischen, aber später auch in der politischen Debatte eine Rolle gespielt haben. Dabei ging es darum, die überkommenen defizitorientierten Altersbilder zu überwinden. Aber das hat letztlich zu einem neuen Problem geführt, nämlich dass wir jetzt einseitig positive Bilder des Alterns haben, die uns schrecklich unter Druck setzen können. Dann gelten Krankheiten oder Gebrechlichkeit als persönliches Versagen und Abweichung vom Standard der fitten und aktiven „Turnschuh-Alten“, der „Silver Ager“.
Einseitig positive Altersbilder sind also mithin keine Lösung ...
Schweda: Das ursprünglich aus den USA stammende Konzept des Successful Aging spiegelt gesellschaftliche Wertvorstellungen wider, die nicht wirklich gut reflektiert sind, und das ist ein Problem. Dass sie einer kritischen Betrachtung bedürfen, ist ein Ergebnis des Forschungsprojekts. Wir brauchen differenzierte Altersbilder. Dem Altern als Prozess der Individualisierung und der Heterogenität der Gruppe der Älteren müssen wir Rechnung tragen, und das kann ein einziges Altersbild nicht. Das Altern ist ein ambivalentes Geschehen mit positiven und negativen Seiten, das sowohl individuell als auch gesellschaftlich ganz unterschiedlich ausfallen kann.
Zieschang: Überall in der Welt verändern sich die sozialen Strukturen und die Begegnung mit dem Alter. Es ist wichtig, dass man keinen Druck erzeugt mit der Vorgabe, jede und jeder müsse jetzt so und so altern. Was gutes Altern bedeutet, ist individuell und von der eigenen Historie beeinflusst. Bei Patientinnen und Patienten, die in den 1920er-Jahren geboren sind, reicht oft eine gewisse Sicherheit – ein Dach über dem Kopf und genug zu essen zu haben, versorgt und von den wichtigsten Erinnerungsstücken umgeben zu sein – und zu wissen, dass aus den Kindern etwas geworden ist. Schon die 30er-, aber erst recht die 40er-Jahrgänge sind da typischerweise weniger genügsam.
Schweda: Das Alter ist letztlich Spiegel der Gesellschaft. Gerade rückt die Babyboomer-Generation ins Rentenalter vor, für die Ideale von Selbstverwirklichung und anhaltender Aktivität und Jugendlichkeit vielfach zur Vorstellung eines guten Lebens gehören. Das dürfte unser Bild des Alterns nachhaltig verändern. Allerdings könnte es auch zu einem Clash kommen, wenn diese Ansprüche irgendwann mit unausweichlichen Realitäten des Älterwerdens konfrontiert werden. Darauf bin ich gespannt. Im erwähnten Forschungsprojekt haben wir auch empirisch gearbeitet und alternde Menschen – es betrifft uns ja alle – dazu befragt, was eigentlich für sie ein gutes, gelingendes Leben im höheren Alter ist. Dabei haben wir gesehen, dass die Vorstellungen sehr verschieden sind und dass Gesundheit zwar wichtig ist, aber bei Weitem nicht die dominante Rolle spielt. Dass vielmehr Aspekte der Teilhabe, der Bildung, der Betätigung im Vordergrund stehen. Wir müssen mithin die Leute selbst fragen und nicht nur von Experten formulierte Leitbilder berücksichtigen.
Frau Zieschang, Sie erwähnten die große Bedeutung sozialer Ressourcen – dabei fallen in Zeiten der Corona-Pandemie etwa soziale Kontakte vielfach weg. Wie bewerten Sie zum Beispiel die Einschränkungen für Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen?
Zieschang: Das ist ein kontroverses Thema, da diese ja nicht selbst darüber entschieden haben, sondern letztendlich die Leitung des Pflegeheims oder die Politik. Für Senioren, die zu Hause wohnen, war und ist die Abwägung auch nicht leicht. Wie sich bei ihnen die Einschränkungen psychosozial oder hinsichtlich der körperlichen Fitness auswirken, untersuchen wir gerade in einem Forschungsprojekt bei Menschen ab 60. Im Pflegeheim, ähnlich in Reha und Krankenhaus, waren extrem einschneidende Einschränkungen einfach vorgegeben. Patientinnen und Patienten können vielleicht noch sagen, unter den Bedingungen mache ich keine Reha oder breche bestimmte Behandlungen ab – aber das Pflegeheim ist für die Menschen dort deren Zuhause. Trotzdem waren sie in die Diskussion nicht eingebunden. Das finde ich schwierig, zumal wir beim Etablieren einer Impfung über einen Zeitraum sprechen, der über die verbleibende Lebenszeit vieler Heimbewohner hinaus andauern dürfte. Für manche bedeutet es eine lebenslängliche Einschränkung.
Wie bewerten Sie das aus ethischer Sicht?
Schweda: In ungewisser Lage zunächst Vorsicht walten zu lassen und weitreichende Schutzmaßnahmen zu ergreifen, war richtig. Mittlerweile können wir die Gefahren besser einschätzen und sind nun in der Pflicht, genau zu prüfen, was tatsächlich notwendig und effektiv ist. Wir müssen auch kreative Lösungen finden, etwa mit Blick auf Pflegeheime. Es ist ein stetes Abwägen von Infektionsschutz mit Grund- und Freiheitsrechten, Lebensqualität und Gesundheit.
Zieschang: Positiv finde ich, dass in Deutschland von vornherein klar entschieden wurde: Wir schützen vulnerable Gruppen, darunter Senioren, und sind bereit, gesellschaftlich und ökonomisch dafür einen hohen Preis zu bezahlen. Es ist ein sehr großes Opfer der Gemeinschaft, das ich auch als starken Schutz für uns Versorger im Gesundheitswesen sehe. Die Nachwehen etwa in Italien, Frankreich, Spanien, die es schon zu Beginn der Pandemie hart getroffen hat, werden wir noch sehen – etwa in Form posttraumatischer Belastungsstörungen oder auch einer emotionalen Verrohung in einem ohnehin ökonomisierten Gesundheitswesen. Auch all das gilt es künftig zu erforschen.
Eben fiel der Begriff der Vulnerabilität, der Verletzlichkeit. Dazu haben Sie, Herr Schweda, in einem Projekt geforscht und sind der Frage nachgegangen, wozu die Vulnerabilität der älteren Generation verpflichtet in moralischer Hinsicht. Wie lässt sich diese Frage beantworten?
Schweda: In der Moralphilosophie gibt es Ansätze, die sagen, dass unsere Verletzlichkeit letztlich die Wurzel von Moral überhaupt bildet. Wenn wir als Menschen nicht vulnerabel wären, wenn wir aus Stahlbeton wären, bräuchten wir keine Moral. Moral hat etwas zu tun mit Rücksichtnahme, mit Sensibilität für unsere jeweilige Schutz- und Hilfsbedürftigkeit. Insofern ist Vulnerabilität zunächst einmal ein grundlegender Zug aller Menschen. Und dann gibt es besonders vulnerable Gruppen, wie wir sie etwa in der Forschungsethik in den Blick nehmen: Brauchen etwa Schwangere in medizinischen Studien besonderen Schutz? Wie sieht es mit Kindern oder älteren Menschen aus, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, etwa mit Demenz? Gegenüber Personen, die ein besonders hohes Risiko haben, in ihren Interessen verletzt zu werden, sind wir zu besonderen Schutzmaßnahmen verpflichtet.
„Bei dementen Patienten bleibt dennoch oft ein emotionales Erinnern.“ (Tania Zieschang)
Sie haben gerade eine vulnerable Gruppe erwähnt, diejenige der Demenzkranken, zu der Sie beide forschen – möglicherweise künftig auch gemeinsam. Was beschäftigt Sie diesbezüglich?
Zieschang: Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, ist in den letzten Jahrzehnten gesunken. Aber da es insgesamt mehr Ältere gibt, steigen die absoluten Zahlen. Da die Krankenhäuser heute viele Eingriffe möglichst ambulant durchführen, steigt in den Kliniken der Anteil der besonders Vulnerablen und somit Älteren: Heute haben 40 Prozent der Akutpatienten über 65 im Krankenhaus eine kognitive Einschränkung. Die besonderen Anforderungen an deren Behandlung beschäftigen mich seit meinem Einstieg in die Versorgungsforschung, als ich als junge Ärztin im Heidelberger Bethanien-Krankenhaus einen Spezialbereich für Menschen mit Demenz mit eingerichtet habe. Es war das erste Projekt dieser Art, das hierzulande publiziert wurde.
Nun haben Sie ein Forschungsprojekt gestartet, in dem Sie in Oldenburg zwar nicht eine neue Spezialstation einrichten, aber in der Pflege ein anderes System schaffen. Gibt es erste Erkenntnisse?
Zieschang: In unserem Projekt gibt es sogenannte Bezugspflegekräfte, die nicht im Schichtdienst arbeiten und ausschließlich für die Demenzerkrankten zuständig sind. Davon scheinen diese Patienten sehr zu profitieren. Daneben evaluieren wir auch, wie das restliche Pflegeteam der Station das erlebt. Zwar gibt es nun zusätzliche Mitarbeiter, die sich um „schwierige“ Patienten kümmern. Aber das bedarf auch zusätzlicher Absprachen und es muss sichergestellt sein, dass sich rund um die Uhr jemand verantwortlich fühlt. Dass die Bezugspflegekräfte flexiblere Arbeitszeiten haben und weniger Patienten intensiver betreuen, könnte auch Neid auslösen.
Sind technische Assistenzsysteme in der Pflege eine Alternative, Herr Schweda?
Schweda: Smarte Technologien, die in der Pflege unterstützen, sind einfach im Kommen. Sie halten Einzug in die Pflege älterer Menschen im Allgemeinen und in die Versorgung von Menschen mit Demenz im Besonderen. Da stellen sich eine Reihe von ethischen Fragen zur Qualität der Versorgung, auch die Frage: Was macht das überhaupt mit Betroffenen, mit Monitoring-Systemen oder beispielsweise einem „Social Robot“ zu interagieren? Gerade wenn ich kognitiv beeinträchtigt bin, kann ich möglicherweise gar nicht verstehen, was da passiert. Die Auswirkungen auf Patientinnen und Patienten und auch auf ihre Angehörigen schauen wir uns gerade in einem Projekt genauer an, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Privatheit.
Sie wollen auch mit den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern solcher Technologien sprechen. Haben Sie mit der empirischen Arbeit schon begonnen?
Schweda: Pandemiebedingt noch nicht. Aber meine Forschung hat ja auch theoretische Anteile – es geht darum, Perspektiven, Kategorien, ethische Prinzipien zu erarbeiten und auf ein konkretes Problem anzuwenden. Und was sich da schon feststellen lässt: Privatheit ist zwar ein großes Thema in der ethischen Debatte, wenn es etwa darum geht, in der Pflege bestimmte Vitalfunktionen, physiologische Parameter oder auch alltägliche Aktivitäten fortlaufend zu überwachen und zu kontrollieren. Aber bei Demenz scheint diese Kategorie in den Hintergrund zu treten. Es gibt wenige Beiträge, die sich systematisch auseinandersetzen mit Privatheit von Menschen mit Demenz im Allgemeinen und in diesem technischen Kontext im Besonderen.
Sie brauchen vermeintlich keine Privatheit?
Schweda: Das scheint eine verbreitete Auffassung zu sein. Unser Projekt geht aber davon aus, dass Menschen mit Demenz sehr wohl ihre Privatheit brauchen und wir vielleicht diesen Begriff anders fassen müssen, um das angemessen abzubilden – auch wenn eine Person vielleicht gar nicht mehr mitbekommt, ob gerade ihre Privatsphäre verletzt wird.
Zieschang: Oder es gleich wieder vergessen hat.
Schweda: Daher müssen wir Privatheit vielleicht anders denken. Wir müssen überlegen, was es über den Schutz von personenbezogenen Daten hinaus eigentlich für uns alle bedeutet, eine Privatsphäre zu haben. Gerade in der häuslichen Pflege, wo es um einen sehr intimen Kontakt und ein vertrautes Umfeld geht, verändert sich etwas, wenn auf einmal Technologien Einzug halten. Das wollen wir in den Interviews ergründen.
Zieschang: Was sich sicher viele nicht klarmachen: Bei Patienten, deren Kurzzeitgedächtnis gestört ist, bleibt dennoch oft ein emotionales Erinnern an Situationen. Das heißt, an Begegnungen mögen diejenigen sich kognitiv nicht erinnern, aber es bleiben durchaus Gefühle – ob ich mich gut aufgehoben oder im Gegenteil unverstanden fühle. Mit jeder positiven Interaktion stützen wir Patientinnen und Patienten auch längerfristig.
Die emotionale Dimension bleibt.
Schweda: Und das zeigt beispielhaft, was die Beschäftigung mit Demenz uns allen bringen kann: Sie macht Dimensionen des Menschseins sichtbar, die wir oft ignorieren. Der US-Bioethiker Stephen Post sagt, dass wir in einer „hyperkognitiven Gesellschaft“ leben mit einem auf rationale Selbstbestimmung und Lebensgestaltung fixierten Menschenbild. Das blendet vieles aus: die Körperlichkeit, die Emotionalität und Affektivität. Ich persönlich lerne in der Auseinandersetzung mit Demenz, dass wir auch ethische Probleme noch einmal anders denken müssen.
Zieschang: Ich habe schon viele Familien erlebt, wo eine Demenzerkrankung den Beziehungen der anderen zu der erkrankten Person eine ganz andere emotionale Tiefe gegeben hat. Das habe ich besonders eindrücklich mit Männern erlebt, die in den 1920er-Jahren geboren wurden, die vielleicht ihr Leben lang nur wenige Emotionen gezeigt haben, und dann bröselt auf einmal dieses ganze Kognitive weg und dahinter kommt ein Kern zum Vorschein. Manche Familien gehen gestärkt daraus hervor und haben das Gefühl, diese Person überhaupt erst richtig kennengelernt zu haben.
Schweda: Leider propagieren wir als Gesellschaft ein Bild von Demenz, das suggeriert, es könnte uns nichts Schlimmeres passieren. In dieser Logik scheint manchen selbst der Tod einem Leben mit Demenz vorzuziehen. Daran müssen wir arbeiten. Es geht nicht darum, die Demenz und die Dramatik, die mit ihr einhergeht, zu verharmlosen. Aber diese überzogene Schwarzmalerei, die eben mit diesem einseitigen Selbstbild zu tun hat, das ja auch narzisstisch ist …
Zieschang: Wenn zum Beispiel Prominente bei der Diagnose Demenz den Freitod wählen, da ist so viel Eitelkeit drin – man kann überhaupt nicht zulassen, dass die Fassade bröckelt.
Und den Kontrollverlust.
Zieschang: Genau.
Schweda: Was die Auseinandersetzung mit dem Altern und dem höheren Lebensalter uns generell lehren kann, ist, die Begrenztheit unserer Möglichkeiten und Kapazitäten zu akzeptieren. Und es nicht als eine narzisstische Kränkung anzusehen, dass wir endlich und begrenzt sind, sondern als Teil unserer menschlichen Existenz.
Zieschang: Und dass wir das Ende nicht selbst bestimmen können. Dass man irgendwann loslassen muss.
Interview: Deike Stolz
Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe des Forschungsmagazins EINBLICKE.